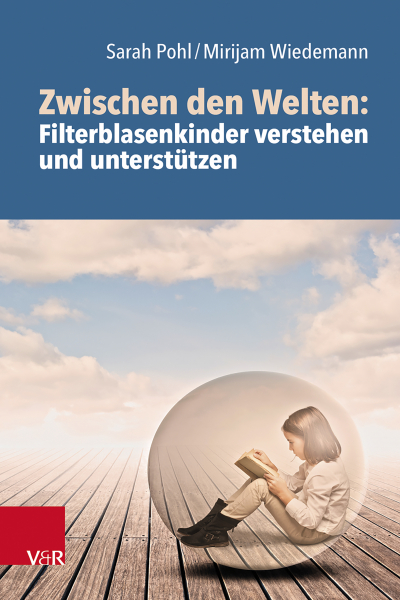Ob Menschen religiös oder nicht-religiös werden, hängt in Zeiten des gesellschaftlichen Rückgangs von Religion nach einer internationalen Studie entscheidend von der Familie ab. Die Studie bestätigt einen massiven Traditionsabbruch, dem die Kirchen nicht einfach entgegenwirken können. Für die Zukunft erwartet Religionssoziologin Christel Gärtner von der Universität Münster einen weiteren kontinuierlichen Rückgang, schlussfolgert aber nicht, dass Religion verschwinden wird. Vielmehr wird sie in bestimmten Milieus und unter spezifischen Bedingungen weiter existieren, erläutert sie im Podcast Conny&Kurt. Die Bedingungen für die Weitergabe innerhalb der Familien werden jedoch schwieriger. Eltern, die ihren Kindern Religion vermitteln möchten, sehen sich manchmal mit Gemeinden konfrontiert, die so konservativ sind, dass sie befürchten, ihre Kinder könnten kein positives Gottesbild entwickeln. Dies birgt das Risiko weiterer Abbrüche.
Für die Kirche formulieren die Forscher:innen der internationalen Studie klare Empfehlungen: Sie müssen Orte bleiben, die Familien integrieren, Vergemeinschaftung und Kreativität ermöglichen und Diskursräume für die Fragen der Jugendlichen bieten, anstatt zu indoktrinieren. Kirchliche Dogmen werden heute kaum noch geglaubt oder verstanden. Das Angebot von Antworten und Räumen für die Reflexion der Adoleszenten wird als entscheidend für die Bindung der jungen Generation an die Kirche angesehen, da auch nicht-religiöse Jugendliche eine Sehnsucht nach solchen Auseinandersetzungsräumen zeigen. Eine theologische oder pädagogische Kompetenz in den Familien erleichtert die Vermittlung von Religion erheblich, da Zusammenhänge besser erläutert und erklärt werden können. Die länderübergreifenden Studie, an der auch Christel Gärtner mitgearbeitet hat, wirft ein Schlaglicht auf den tiefgreifenden Wandel der religiösen Sozialisation in Familien über mehrere Generationen hinweg. Die Untersuchung, die von der amerikanischen John Templeton Foundation gefördert wurde, analysiert die Weitergabe, Veränderung und den Abbruch von Religion in fünf Ländern mit christlichem Hintergrund: Deutschland, Finnland, Italien, Ungarn und Kanada. Die Ergebnisse zeichnen ein Bild eines fortlaufenden Rückgangs religiöser Praxis und Glaubensinhalte, warnen aber auch vor Verallgemeinerungen und zeigen unterschiedliche regionale Dynamiken auf.
Die Studie nutzte einen Mixed-Method-Ansatz, der repräsentative Fragebogenbefragungen und Familieninterviews umfasste, bei denen bis zu drei Generationen an einen Tisch gebracht wurden. Im Zentrum stand die Frage, wie Religion innerhalb von Familien über die Zeit tradiert wird.
Kindheit als Prägephase, Adoleszenz als Reflexionszeit
Ein zentrales Ergebnis ist die unterschiedliche Rezeption von Religion in verschiedenen Lebensphasen. Kinder nehmen demnach die Form der Religion an, die sie in der Familie erfahren, inklusive Glaubensinhalte, Werte und Rituale. Sie äußern sich oft positiv, wenn die Inhalte kindgerecht vermittelt werden. Mit der Adoleszenz setzt jedoch eine kritische Reflexionsphase ein. Jugendliche beginnen, Fragen an den Glauben und die vermittelten Werte zu stellen und entwickeln eine eigene Position.
Der Glaube schwindet, Rituale bleiben selektiv
Die Weitergabe des Glaubens selbst erweist sich als am schwierigsten. Während Werte und das Gefühl der Zugehörigkeit eine hohe Kontinuität aufweisen – mit Ausnahme Ostdeutschlands –, sehen die Forscher bei kirchlichen Praktiken und Glaubensinhalten einen deutlichen Bruch. Erfolgreich ist die Weitergabe von Religion heute vor allem dann, wenn die gesamte Familie an einem Strang zieht und in eine religiöse Gemeinschaft eingebunden ist, was eine Art Familienidentität schafft.
Die Feier des gesamten Kirchenjahres, wie sie in der Großelterngeneration noch präsent war, ist in der dritten Generation kaum noch zu finden. Stattdessen konzentrieren sich religiöse Praktiken oft auf einzelne Rituale und zentrale Feiertage wie Weihnachten und Ostern, die zunehmend als Familienfeste begangen werden. Rituale wie der St. Martins-Umzug existieren zwar weiter, werden aber oft als „Laternenlauf“ entkonfessionalisiert und über Kindergärten oder Schulen initiiert.
Regionale Unterschiede und die Rolle der Kirche
Der Säkularisierungsprozess verläuft nicht überall gleich. In Ostdeutschland war bereits in der Großelterngeneration ein scharfer Abbruch der kirchlichen Bindung festzustellen, der sich in der DDR durch Kirchenverfolgung und antikirchliche Politik massiv verstärkte. Dies führte dazu, dass Familien über Generationen hinweg eine Nichtreligion weitergaben. In Italien hingegen erfolgte dieser Prozess wesentlich später und kontinuierlicher. Finnland zeigt eine Besonderheit mit einer hohen Zahl an Konfirmationen, die oft als kulturelles Ritual wahrgenommen werden, selbst von nicht getauften Jugendlichen, und scheint den Rückgang zu verlangsamen. Kanada liegt dazwischen, mit regionalen Unterschieden, insbesondere in katholischen Gebieten wie Quebec, wo eine frühere Distanz zur Kirche aufgrund strenger Erziehung entstand. Mütter spielen rein statistisch gesehen in allen untersuchten Ländern die wichtigste Rolle bei der Vermittlung von Religion. Diese Rolle nimmt jedoch über die Generationen hinweg ab. Großmütter können eine vermittelnde Funktion einnehmen, insbesondere in der ersten und zweiten Generation, aber ihre Rolle kann den Rückgang der elterlichen religiösen Sozialisation nicht vollständig kompensieren. Enkel erinnern die religiöse Weitergabe durch Großmütter zudem weniger deutlich als die Elterngeneration.Gtnr, Christel/Hennig, Linda/Müller, Olaf (Hg.) (2025): Families and Religion. Dynamics of Transmission across Generations, Frankfurt a.M./New York. ISBN 978-3-593-51994-4.
Zur Person
Christel Gärtner ist Soziologin und seit 2014 außerplanmäßige Professorin am Fachbereich Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie ist Mentorin der Graduiertenschule im Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Universität Münster und leitet dort das Projekt „Islam und Gender in Deutschland. Zur (De-)Konstruktion säkular und religiös legitimierter Geschlechterordnungen“.