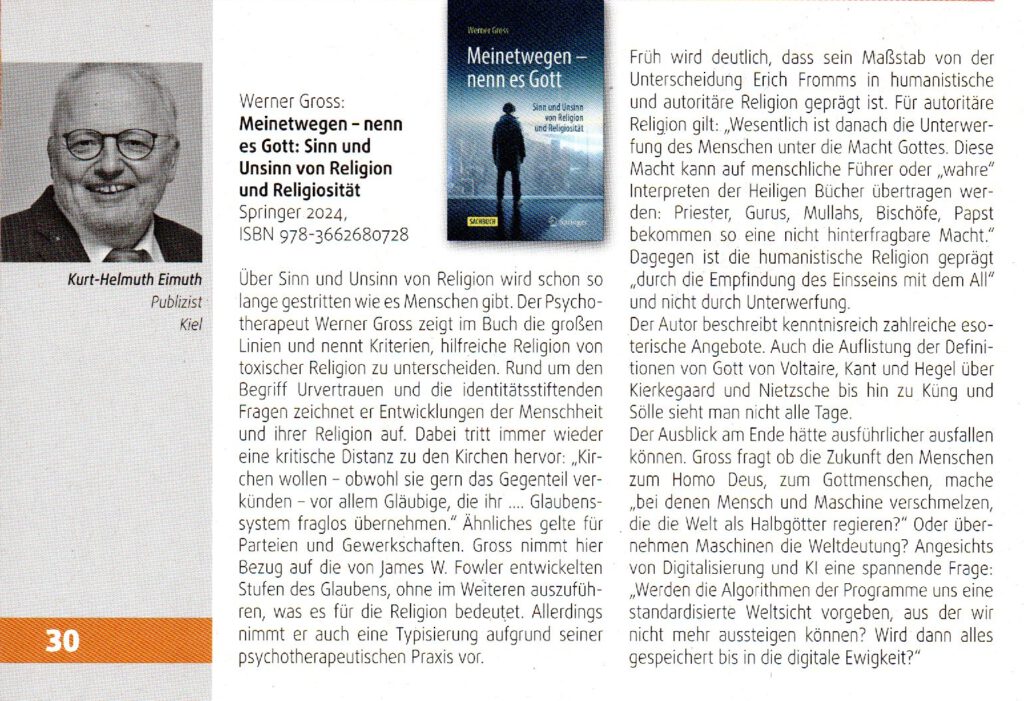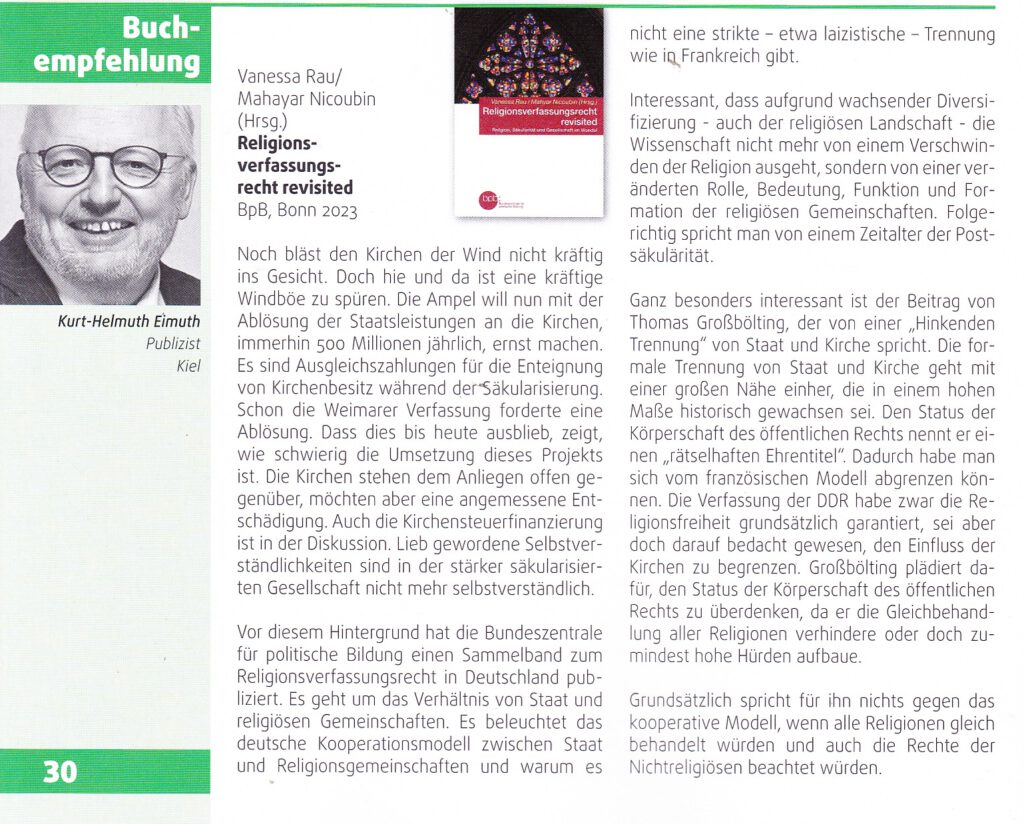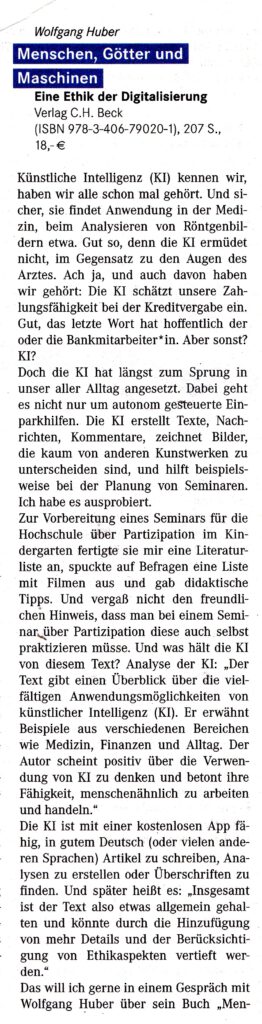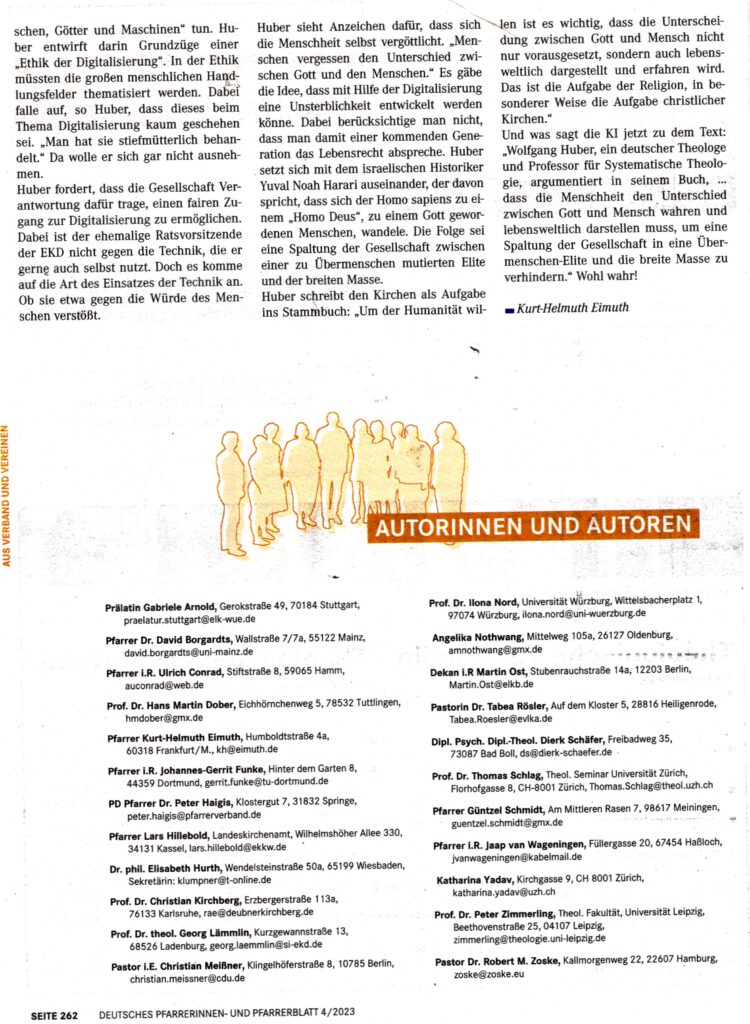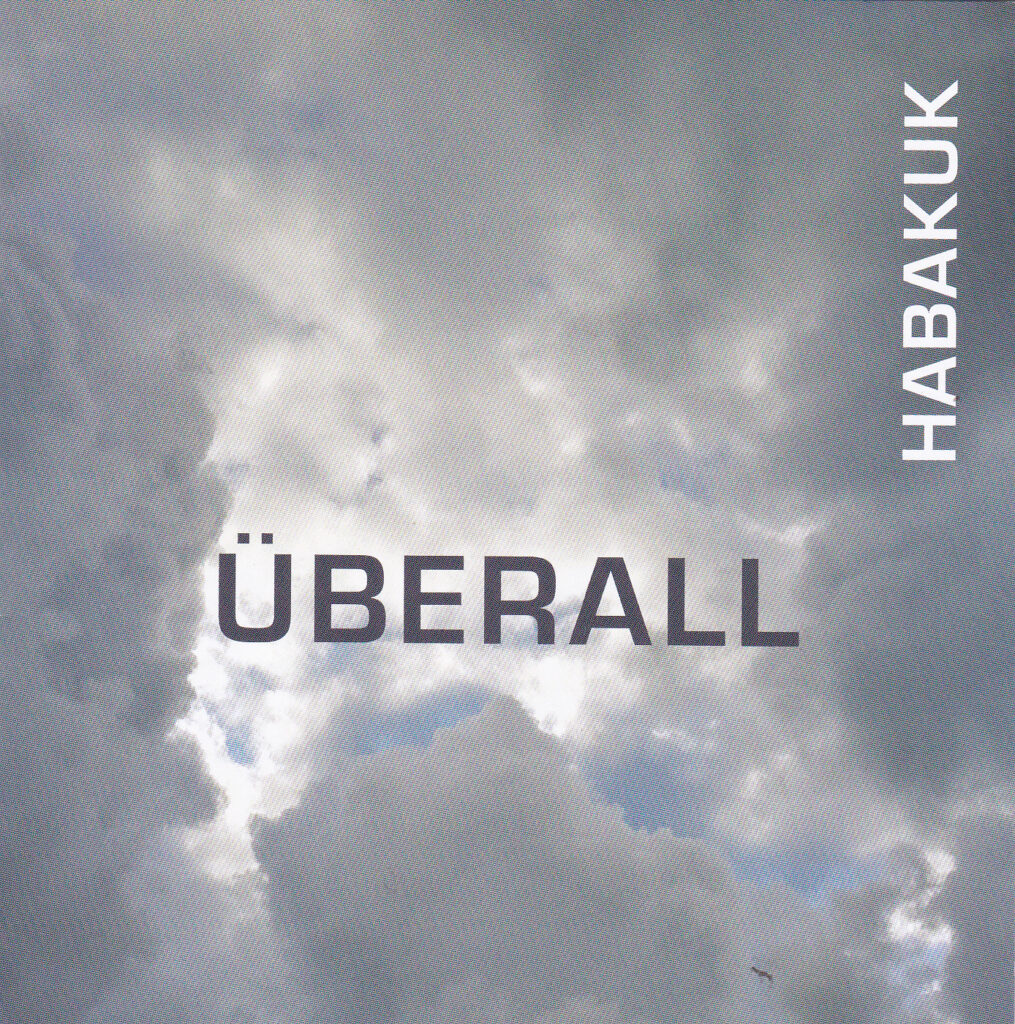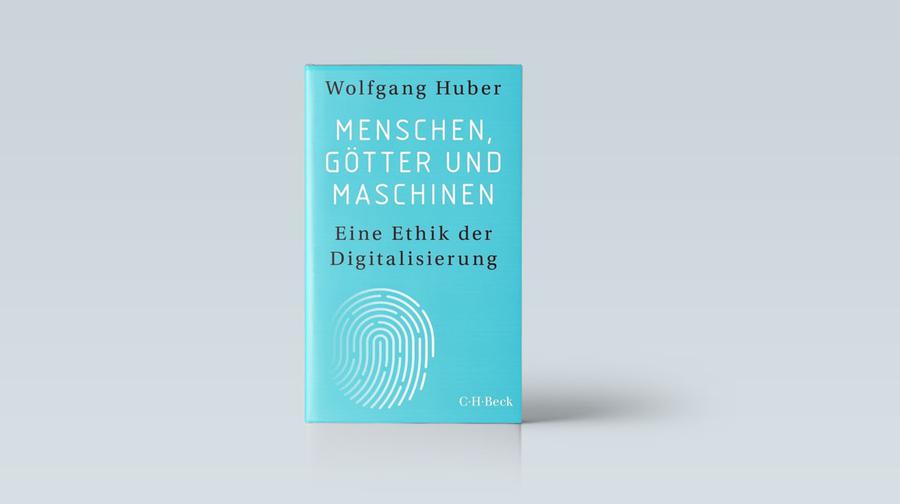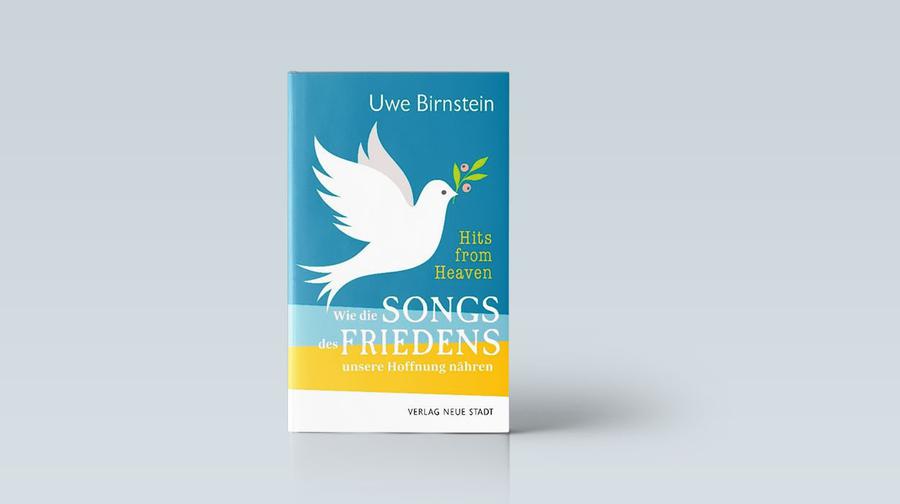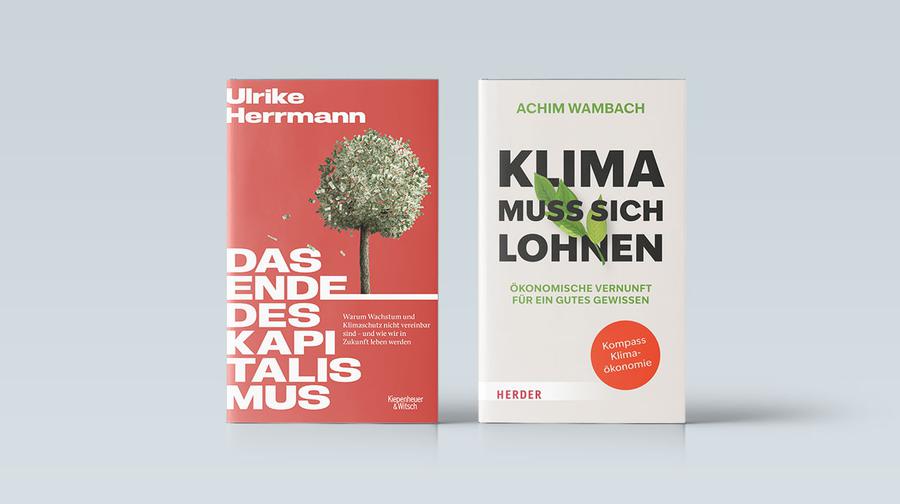Die Internetseite für
evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer
in Deutschland Suchbegriff Suche starten
Klaus-Peter Hufer
Mut zur Demokratie – Nicht zuschauen, sondern handeln
Wochenschau Verlag (ISBN 978-3-7344-1688-0), 14,90 € von Kurt-Helmuth Eimuth

Der Befund treibt Tausende auf die Straße. Unser politisches System ist bedroht, wenn 20-30% den einfachen Antworten hinterherlaufen. Klaus-Peter Hufer, Professor für Erwachsenenbildung an der Universität Duisburg-Essen, fordert dagegen mehr „Mut zur Demokratie“, so der Titel seines Buches. Hufer führt seit über 25 Jahren Workshops durch. In Rollenspielen fordert er dazu auf, sich gegen Stammtischparolen wie „Die da oben machen doch, was sie wollen“ oder „Politik ist ein schmutziges Geschäft“ zu wehren. Die Erfahrung zeige, dass die Gruppe, die die Parolen vertritt, den Diskurs dominiert. Schnell würden die Äußerungen nicht nur antidemokratisch, sondern auch sexistisch, antisemitisch und rassistisch. Ziel der Workshops und wohl auch des hier vorgelegten Buches ist es, angemessene Antworten zu finden.
Der Autor zeigt die geistesgeschichtliche Entwicklung der Idee Demokratie auf. Von Platon und Aristoteles über Morus und Rousseau. Kenntnisreich zitiert er deren Werke. „In Demokratien gibt es Spannungen aufgrund der unterschiedlichen, auch gegensätzlichen Meinungen, Ziele und Lebensweisen der Menschen, die in ihnen leben.“ Doch dies sei nicht schlimm. Im Gegenteil: „Daraus ergeben sich Konflikte, die das Lebenselixier einer vitalen Demokratie sind.“ Es gehe darum, solche Gegensätze auszuhalten, einen Konsens zu suchen oder auch das eigene Interesse vom Allgemeinwohl zu unterscheiden.
Das Buch ist dabei immer wieder unterbrochen von Reflexionsfragen und zahlreichen Bezügen zum Alltag, zur Lebenswelt. Demokratie fände nicht nur im System (Staat, Institutionen) statt, sondern eben auch in der individuellen Lebenswelt. So sei eine demokratische Gesellschaft quasi ein Ping-Pong-Spiel zwischen Lebenswelt und System. Etwa wenn durch einen Neubau mein Blickfeld eingeschränkt würde, aber auf der anderen Seite Wohnungsbau dringend erforderlich sei. Dann beginnen die Aushandlungsprozesse. „Das Leben in einer Demokratie ist eine hochkomplexe Anforderung an alle, an jede und jeden. Demokratie ist kein Ich-Projekt oder ein Erst-Komm-ich-Unternehmen. Demokratie ist eine Zumutung.“
Hufer analysiert die Megatrends der Verunsicherungen: Individualisierung, Globalisierung, Migration, Ökonomisierung und Digitalisierung. Unbeachtet bisher, dass die Individualisierung oftmals mit Einsamkeit einhergeht. Menschen, die sich einsam fühlen, haben ein höheres Krisenempfinden und sind anfälliger für Populismus und rechtsextreme Einstellungen. „Einsamkeit kann also ein ‚Sprengstoff‘ für die Demokratie sein.“
Aufgrund der Megatrends geht der Einfluss der „Ligaturen“, wie es der Soziologe Ralf Dahrendorf nannte, zurück. Jene Institutionen, die durch tiefe kulturelle Bindungen den Menschen einen Weg durch die Welt der Optionen hilft zu finden. Hier müsse die Zivilgesellschaft einspringen. Eine der Ligaturen sind die Kirchen. Ihr Einfluss ist geschrumpft. Wäre es nicht trotzdem ihre Aufgabe zumindest eine Plattform für den Diskurs zu sein?
Die Handlungsweise von autoritären Politikern (männlich!) beschreibt Hufer so: „Sicher ist, dass Minderheitenrechte infrage gestellt, Lebensstile attackiert oder sogar verboten werden. Autoritäre und rechte Politiker wollen die Kontrolle über die Medien und die Justiz übernehmen und versuchen, Zugewanderte auszugrenzen und abzuschieben. Sie werden internationale Abkommen kündigen.“ Und die Gewaltenteilung aufheben. Eine präzise Beschreibung des Fahrplans von Trump. Hufer hält dies mit Blick auf die Landes- und Kommunalparlamente – durchaus für eine Blaupause für Deutschland.
Dem könne man nur mit einem nachhaltigen und wirkungsvollen Engagement entgegentreten. „Demokratie ist ein dauerhafter Prozess. Sie beginnt im Alltag und setzt sich von da aus fort bis in die höchsten Institutionen des Staates.“ Er fordert dazu auf, Mut zu haben, den Parolen auch im privaten Umfeld entgegenzutreten. Er listet eine Reihe von Institutionen auf, die faktenbasierte Informationen bereithalten wie etwa die Bundeszentrale für politische Bildung.
Hufer zeigt Wege zum Mut zur Demokratie ebenso auf wie die soziologischen wie philosophischen Ursprünge der Staatsform Demokratie. Er begreift Demokratie als lebenslanges Lernen. „Anders gesagt: Durch die Komplexität der Verhältnisse werden unterkomplexe Antworten attraktiv. Komplexität muss erklärt werden, doch es ist mühsam.“
Kurt-Helmuth Eimuth