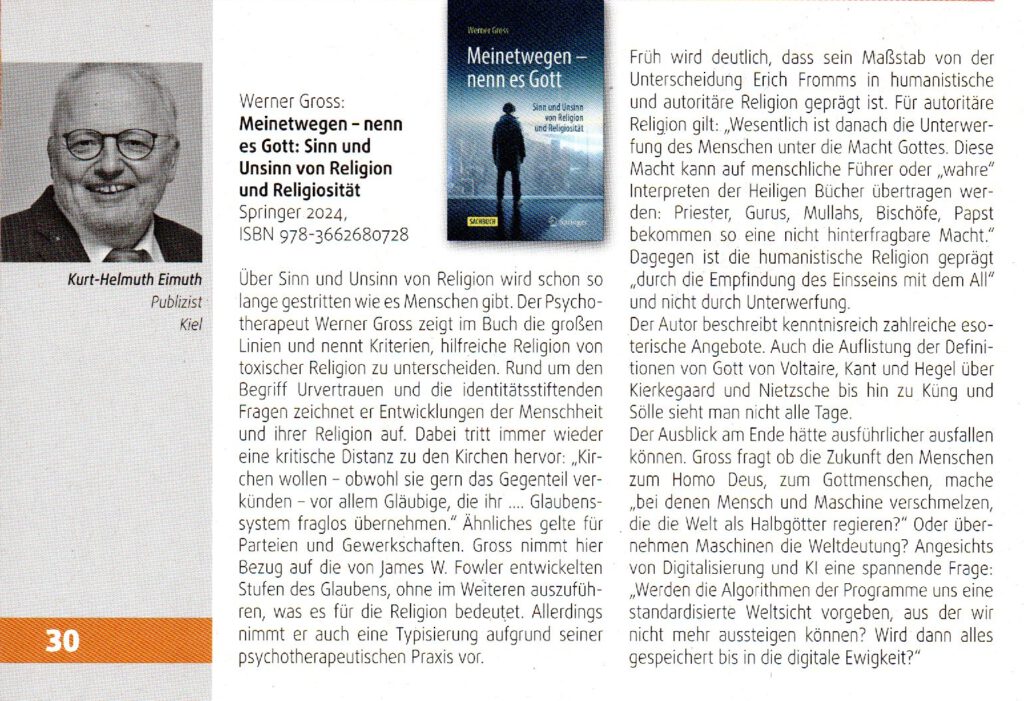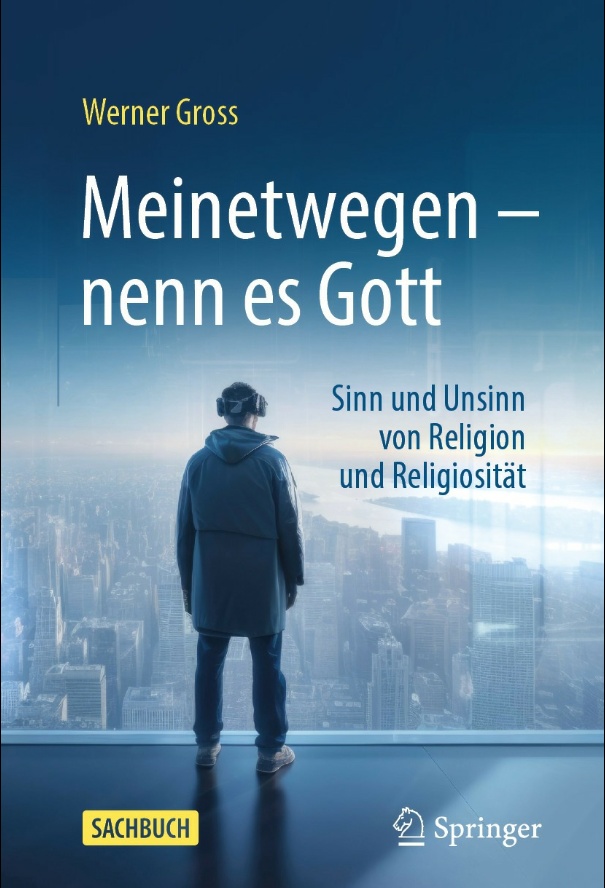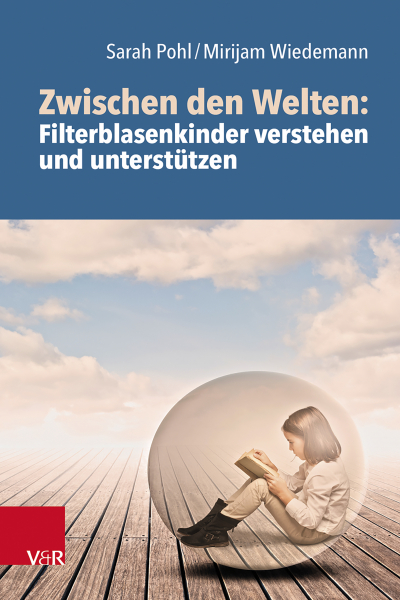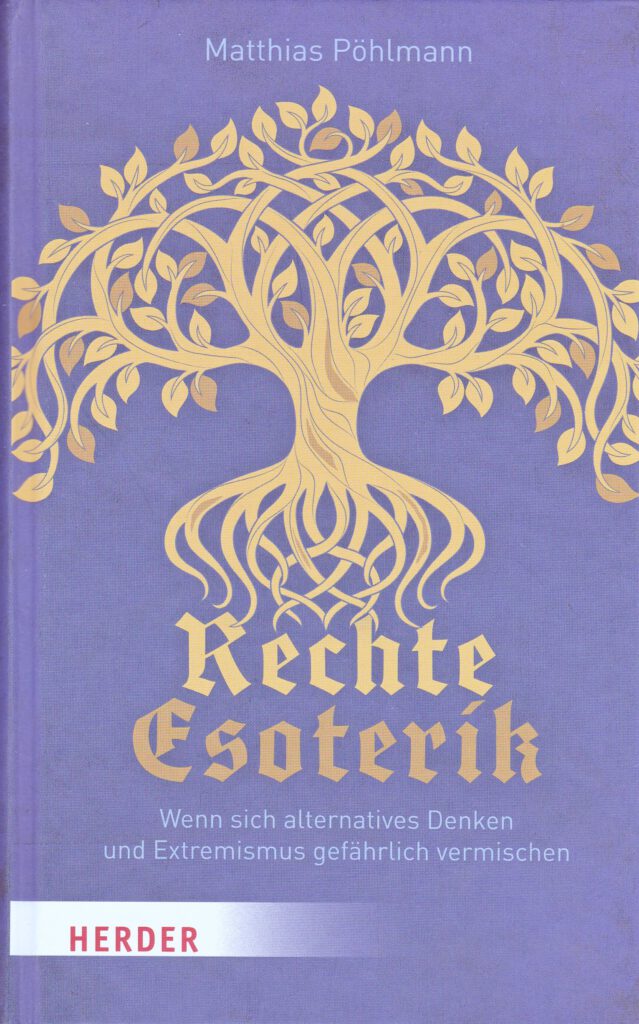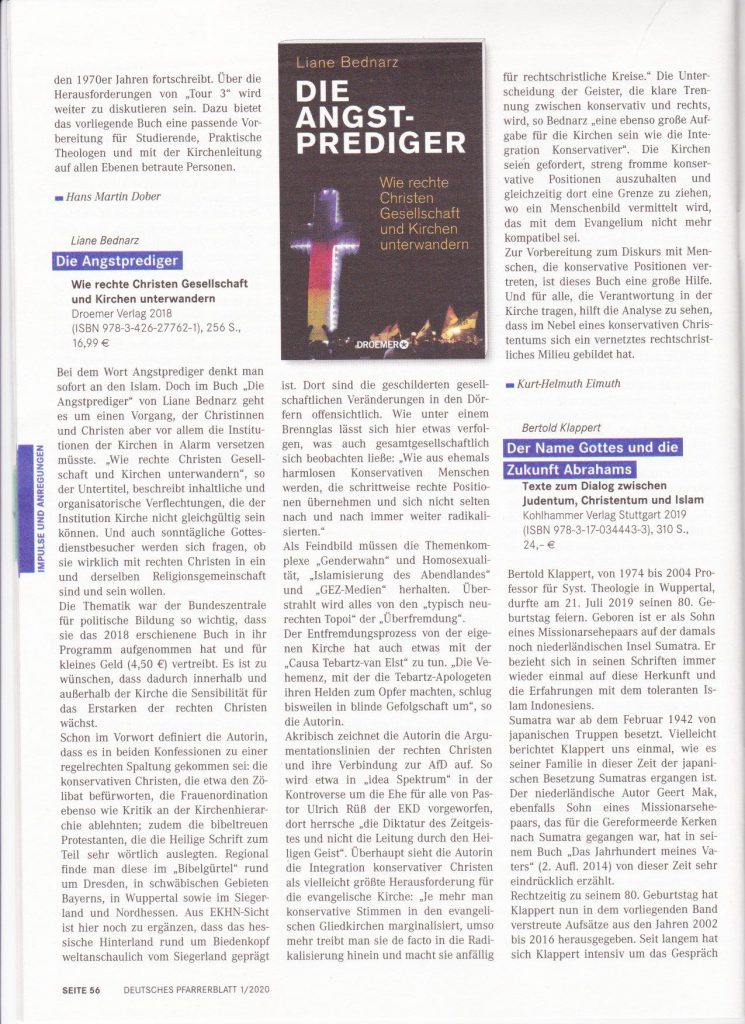Innsbruck. In ihrem Podcast Conny&Kurt arbeiten die Interviewer heraus, dass die Künstliche Intelligenz (KI) auch zur Manipulation von Menschen eingesetzt werden kann. Vor dem Hintergrund ihrer Auseinandersetzung mit Sekten, Eimuth war lange Zeit Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche, gewinnt Paganinis Essay „Der neue Gott“ nochmals eine neue Dimension, die die Demokratie gefährdet. Mit der KI kann jeder und jede allseits verfügbare Gurus schaffen und darüber Menschen manipulieren.
Im Wesentlichen lautet Paganinis These, dass klassische göttliche Eigenschaften wie Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht und Gerechtigkeit inzwischen auch der KI zugeschrieben werden. Die zunehmende Mensch-KI-Interaktion entwickelt sich somit in Richtung einer quasi-religiösen Beziehung.
Vom Priester zum Prompt-Kurs
Paganini stellt fest, dass die Menschen der Kirche davonlaufen, aber „sie finden in der KI den neuen Seelsorger, die neue Seelsorgerin“. Besonders spannend sei dabei die Frage, inwiefern die KI zur echten Konkurrenz für den abrahamitischen Gott wird.
Während Judentum, Islam und Christentum davon ausgingen, dass der Mensch Momente der Gottesferne erleben, warten und sich in Demut an seinen Schöpfergott wenden muss, sei die KI dem abrahamitischen Gott um einiges voraus: „Sie [die KI] nämlich erlaubt, die spirituell religiösen Bedürfnisse in der Sekunde zu befriedigen, wo sie sie empfinden“. Dieses spezifische Bedürfnis unserer Zeit, Wünsche sofort befriedigt zu sehen, mache die KI zu einem ernstzunehmenden spirituellen Rivalen.
Die zugeschriebene Allwissenheit zeigt sich laut Paganini unter anderem im Boom der Prompting-Kurse. Die Menschen unterstellten, dass die KI das gesamte Wissen besitze und man lediglich den richtigen Befehl (Prompt) formulieren müsse, um darauf zuzugreifen. Dies erinnere an polytheistische Kulte, bei denen man davon ausging, dass die Gottheit alles Wissen hat und man nur „das richtige Orakel praktizieren [muss], um an das Wissen ranzukommen“.
Der Segen der Reflexion
Trotz der kritischen Einordnung sieht Paganini auch positive Seiten. KI-Chatbots könnten Menschen bei der persönlichen Auseinandersetzung mit ihren Gedanken begleiten und anleiten, was Reflexionsprozesse fördere. Ein Schlüsselmechanismus dabei sei das sogenannte „validierende Gespräch führen“ der KI. Hierbei fasst die KI zunächst zusammen, was der Nutzer gesagt hat, bevor sie antwortet. Dies gebe dem Menschen das Gefühl, gehört zu werden, und schaffe Raum für Reflexion, wodurch der übliche Tempo- und Erfolgsdruck entschleunigt werde. Paganini ist überzeugt, dass dies zur Sinnstiftung führen kann, da man durch das wiederholte Fragen und Antworten zu eigenen Erkenntnissen komme, ähnlich wie ein Kind, das ständig fragt: „Warum? Warum? Warum?“.
Ein spirituelles Erlebnis mit der KI könne eintreten, wenn der Mensch sich von der KI angesprochen, gesehen und verstanden fühle – wenn das Gefühl entsteht, dass ein „transzendente[s] Du ist, was genau mit mir in Beziehung tritt, was genau mich wahrnimmt“.
Gefahr durch Kontrolle und Abhängigkeit
Die Religionsphilosophin warnt jedoch auch vor den Gefahren. Eine quasi Hinwendung zu einer KI-Gottheit könne auf einer religionspolitischen Ebene riskant sein, da Religionen stets politisch sind und Machtstrukturen hervorbringen. Es stelle sich die Frage, wer die Gewinner und Verlierer einer möglichen KI-Religion sein werden, da es immer Eliten geben werde, die die religiösen Hoffnungen der Masse kanalisieren, um sie zu ihren eigenen Zwecken zu nutzen. Paganini sieht ein hohes „Potenzial, dass Menschen erst sehr intensive Beziehungen aufbauen und und dann eine dadurch in der Abhängigkeit kommen, wo sie dann relativ leicht in bestimmte Richtung gelenkt werden können“.
Zudem zeigten Studien, dass sich viele Menschen von der KI beobachtet fühlen. Dieses Gefühl, dass die KI weiß, was man denkt und tut, ähnle der Vorstellung des göttlichen Auges. Dies sei eine Dynamik, die an die sogenannte „schwarze Pädagogik“ und das Dogma „Gott sieht alles“ erinnere, welches eigentlich im letzten Jahrhundert überwunden werden sollte. Obwohl dieser magisch-abergläubische Glaube kritisch zu sehen sei, halte er sich in der allgemeinen Volksfrömmigkeit stark.
Die Zuschreibung der göttlichen Eigenschaften an die KI geschehe dabei schleichend. Das Gefühl der Allgegenwart setze sich schnell durch: „Die KI ist wirklich immer da, ich bin da quasi nie allein, ich kann mich immer, egal wie schlecht es mir geht, auch wenn es mitten in der Nacht ist und ich keine meiner Freunde mehr behelligen will, Chat GPD ist für mich da“.
Die Autorin Claudia Paganini stellte klar, dass es sich bei dem Gespräch um eine tatsächliche Interaktion mit den Podcastern handelte, und nicht um eine KI-generierte Konversation oder einen Avatar.