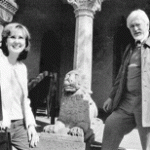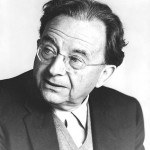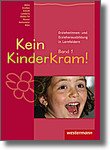15.1.2005
Pfarrerin Marion Eimuth
Letzter Sonntag nach Epiphanias (24.1.99)
Predigttext
2. Mose 3,1-10 (11-14)
Orgelvorspiel
Gemeinde: Eingangslied: EG 70, 1+4
Zum heutigen Sonntag, begrüße ich Sie ganz herzlich mit dem
Wochenspruch bei dem Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 2:
Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes
Gott ist uns nahe – immer und überall,
im Namen Jesu Christi – So sind wir geliebt,
und im Namen des Heiligen Geistes
So sind wir verbunden als Schwestern und Brüder.
Psalm 97
Der Herr ist König: des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit,
und seine Herrlichkeit sehen alle Völker.
Schämen sollen sich alle, die Bildern dienen
und sich der Götzen rühmen.
Betet ihn an, alle Götter!
Zion hört es und ist froh,
und die Töchter Juda sind fröhlich,
weil du, Herr, recht regierest.
Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen,
du bist doch erhöht über alle Götter.
Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge!
Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen;
auder Hand des Gottlosen wird er sie erretten.
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen.
Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
Kommt, lasst uns anbeten:
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn…
Pfarrerin: Sündenbekenntnis
Gott, wie oft kommt es vor, dass wir uns überschätzen.
Wir fühlen uns stark und vergessen, wer uns mit Stärke ausgestattet hat.
Aus eigener Kraft wollen wir das Leben gestalten.
Manchmal erzwingen wir Veränderungen,
die uns und anderen nicht gut tun.
Wir bitten dich, lenke unsere Gedanken und Blicke auf dich.
Du allein bist unsere Stärke und Kraft.
Du schenkst uns Zuversicht.
Hilf uns, dass wir dir allein vertrauen.
Darum bitten wir: Erbare dich!
Gemeinde: Herre, Gott, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herre, Gott, erbarme dich!
Pfarrerin: Gnadenwort:
Christus spricht: „Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.“
Ehre sei Gott in der Höhe.
Gemeinde: Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;
nun ist groß Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende.
Pfarrerin: Gebet:
Gott, du bist Licht und Heil.
Lass uns dein Licht aufgehen und fülle unsere Herzen mit dem Feuer deiner göttlichen Liebe.
Deine wahrheit leuchte in uns und schenke uns Klarheit für unser Tun und Lassen.
Im Glauben wollen wir weitergeben, was du uns schenkst durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
- Schriftlesung:
Epistel: 2. Korinther 4,6-10
Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werde.
Halleluja
Gemeinde: Halleluja, Halleluja, Halleluja
Gemeinde: EG 72, 1-6
2. Schriftlesung:
Evangelium: Matthäus 17,1-9
Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm.
Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!
Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist
„Ehre sei dir Herr!“
Gemeinde: Lob sei dir, o Christe!
Pfarrer und Gemeinde:
Lasst uns Gott loben und preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens:
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde;
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige, christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
Gemeide: EG, 67, 1-4
Pfarrerin: Predigt:
2. Mose 3, 1-14
1 Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 2 Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, daß der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. 3 Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. 4 Als aber der HERR sah, daß er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. 5 Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land!
6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 7 Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 8 Und ich bin herniedergefahren, daß ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. 9 Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, 10 so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.
11 Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, daß ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? 12 Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, daß ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. 13 Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt! und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? 14 Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: „Ich werde sein“, der hat mich zu euch gesandt.]
Liebe Gemeinde,
Wer ist Gott?
Ist das eine Frage, die einer beantworten kann? Ist das eine Frage, die Menschen überhaupt bewegt?
Wer ist Gott?
Manchmal an einem Wintertag, wenn der Rauhreif an den Ästen klebt und der Atem in der klaren Luft zu sehen ist und der blaue Himmel sich über einen wölbt, dann meine ich zu ahnen, wer Gott ist: Der alles wunderbar gemacht hat und dem ich ein dankbares Lied singen sollte, bevor ich etwas anpacke.
Oder wenn ich Musik höre, die mein Herz bewegt, die nicht laut, sondern leise mich in Schwingung bringt und ich mich bewegt fühle und geborgen zugleich, dann ahne ich: Gott liebt die Schönheit und hat mir meine Sinne geschenkt, sie wahrzunehmen.
Oder ich merke im nachhinein: Hier ist mir etwas gut gelungen, was ich gemacht habe, und eine hat mich auch dafür gelobt. Dann merke ich: Es wachsen mir manchmal Kräfte zu, die nicht von mir selber kommen, und für die ich nur danken kann.
Wer ist Gott?
Viele wissen keine Antwort auf diese Frage.
Es gibt viele, für die ist die Frage nach Gott ein abgeschlossenes Kapitel. Sie haben resigniert, sind müde, weil sie meinen: Gott ist weit weg von dem Leben, das ich führen muß, weit weg von den Problemen, die ich zu bewältigen habe vom Morgen bis zum Abend. Und gelegentlich ist auch dabei die Enttäuschung zu hören über diejenigen, die so leicht von Gott reden können, und die so wenig sich einfühlen können, wenn Menschen hadern.
Die Frage nach dem Wesen Gottes, wer er ist, wie er ist, wie und ob er Menschen erscheint, leuchtet herüber aus der Geschichte aus dem 2. Mosebuch, die wir gehört haben, und die uns heute morgen beschäftigen soll. Es ist der Bibelabschnitt, der am Ende der Epiphaniaszeit, die ja auch das Ende des Weihnachtsfestkreises ist, in allen evangelischen Kirchen gepredigt wird. Es ist die Zeit, die Gottes Erscheinen in der Welt zum Thema hat. Unser Text nun spricht von einer ganz besonderen Erscheinung Gottes, die fremd ist und doch auch faszinierend.
In drei Abschnitten verläuft diese Geschichte, und wir wollen sehen, was sie zu uns heute über unsere Frage nach Gott sagen kann. Die Geschichte erzählt von einer Erscheinung, vom Auftrag und vom Namen Gottes.
Die Erscheinung
Die Geschichte beginnt idyllisch, so daß man es sich gut vorstellen kann: Schafe kommen darin vor und Ziegen wahrscheinlich auch, ein Hirte, eine Steppe, die wenig Nahrung gibt für die Tiere, ein Berg. Eine ruhige Szene eigentlich, und doch wissen die Kenner, wieviel Mühe und Einfachheit des Lebens sich in diesen wenigen Worten unserer Geschichte widerspiegelt. Wievielmal wird der Hirte den Weg mit seinen Tieren schon gegangen sein? Wieviel Gewohnheit ist es und wieviel Sorge, die Tiere wieder heil zurückzubringen?
Nun plötzlich bemerkt Mose auf dem vielmals begangenen Weg eine ungewöhnliche Erscheinung. Er sieht einen Busch, aus dem eine Flamme schlägt. Das weckt seine Neugier. Natürlich will er sehen, was da seltsames sich tut. Und er sieht eine Flamme und einen Busch, der nicht verbrennt.
Hier ist etwas Einzigartiges geschehen, etwas, was nicht nachvollziehbar und kaum verstehbar ist. Es ist die Begegnung mit Gott selbst. Und es liegt einer nicht verkehrt, wenn er an andere Begegnungen Gottes mit Menschen denkt, die die Bibel erzählt. Von Abraham wird so schon berichtet: Er solle hinausgehen und die Sterne am Nachthimmel zählen. Und wir denken an Jakob, der in der Nacht mit einem Fremden ringt, und nachdem Jakob sich nicht von der dunklen Gestalt überwinden läßt, wird er gesegnet.
Mose hört nun: „Dieser Gott deiner Väter bin ich.“
So ist das in der Bibel. Begegnung mit Gott, das ist immer ganz persönlich und überraschend, noch nie so dagewesen und auch wahrscheinlich nicht wiederholbar. Ich weiß nicht, ob wir daraus für uns etwas lernen können, aber es heißt doch sicher dies: Gott scheut sich nicht, dort Menschen zu begegnen, wo sie gehen und gerade leben in ihren Gewohnheiten, dort, wo ihre Sorgen sind und die Mühen des Alltages, dort, wo die Fragen sind und vor allem dort, wo einer nicht oder nicht mehr mit ihm rechnet.
Wir sind nicht Mose.
Und doch erwarten viele ja große Zeichen: Das Ende von Not und Gewalt, und daß kein Kind mehr sich ängstigen muß, weil Eltern von Waffen bedroht sind. Das alles müßte Gott tun und noch mehr.
Könnte es aber nicht sein, daß wir aufmerksamer hinhören und hinsehen könnten auf andere Signale Gottes. Wir werden keine brennenden Dornbüsche sehen und keine übernatürlichen Stimmen hören. Aber vielleicht hören wir ihn in der Stimme, die fragt, ob wir einen Moment Zeit haben, ob wir zuhören können. Vielleicht bemerkt ihn auch einer, wenn er hinsehen muß und sich mitfreuen, weil ein Kind fröhlich über den Gehsteig hüpft, weil es vielleicht eine gute Note in der Schule bekommen hat. Es müssen nicht immer die großen Zeichen sein, in denen Gott erscheint. Kleine, verletzliche übersehbare Zeichen sind wahrscheinlicher. Wie ja auch die Liebe eher verletzlich und manchmal übersehbar daherkommt und doch so viel verändern kann.
Wer nur den lieben Gott läßt walten
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.
Ist das nur ein Liedvers aus alter Zeit, gesungen von einem, dem es gut geht, oder beschreibt er, wie einer Gott begegnen kann? Johann Neumark hat diesen Vers gedichtet, nachdem er auf einer Reise überfallen und ausgeplündert worden war.
Erscheinung Gottes: Merkwürdig eigentlich. Und doch wissen wir, in manchem Krankenzimmer und in mancher schlaflosen Nacht wird dieser Liedvers mit dem eigenen Leben nachbuchstabiert.
Der Auftrag
Unsere Geschichte bleibt nun nicht dabei stehen, daß sie erzählt, wie Gott einem einzelnen Menschen begegnet. Mose hört aus dem Dornbusch etwas von der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Er hört, was er selbst schmerzlich erfahren hat, wie das Volk Israel in Ägypten leiden muß und dies, daß das Elend nun ein Ende haben soll. Israel soll heraus geführt werden aus der Enge in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Leben in Freiheit soll Israel führen. Gott sagt nun zu Mose: „So geh nun du hin, ich will dich senden.“ Und Mose sagt: „Wer bin ich?“ „Wer bin ich schon?“
Man kann das in der Bibel verfolgen. Es gibt keine Begegnung mit Gott ohne Auftrag und keinen Auftrag ohne Einwände. Kaum einer, dem Gott begegnete, willigte ein in den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Wer unser Kapitel im 2. Mosebuch zu Ende liest, der merkt, wie Mose immer wieder neue Einfälle hat, seine Einwände gegen den Auftrag Gottes vorzubringen.
Es ist wohl so: Angesichts einer Aufgabe spürt mancher, wie klein die Kräfte sind und wie kurz der Atem durchzuhalten. Angesichts einer Aufgabe wird der, der ehrlich ist zu sich selbst, sich über seine eigene Situation klar und über seine Möglichkeiten. Wie oft scheitert auch eine an ihrer Aufgabe?
Ist es eine Frage von Qualifikation?
Heute ist es in aller Munde, wie nötig es ist, sich ständig fortzubilden, will man nicht zurückbleiben. In allen Bereichen ist es so.
In unserer Geschichte ist es aber eine Frage von Vertrauen. Mose hört: „Ich will mit dir sein. Ich, Gott, will mit dir sein, verlaß dich nur darauf.“
Könnte es bei einem Auftrag, wenn einer meint: „Wer bin ich schon?“ etwas Schöneres geben als dies, daß einer von Gott hört „Ich will mit dir sein.“?
Wenn einer von uns das heute morgen hörte und es dann damit wagte wäre es schon genug.
Dann könnte es sein, daß eine ihren Auftrag erkennt und in ihrer Einsamkeit sieht, wie sie die Hände falten kann, und so verbunden ist mit den Menschen, an deren Weg sie denkt.
Und es könnte sein, daß einer seinen Auftrag darin sieht dankbarer zu werden, weil er auf der Straße unterwegs schon so oft bewahrt worden ist und ganz knapp am Unfall vorbeigekommen.
Und es könnte sein, daß einer seinen Auftrag spürt darin, doch endlich auch über eigene Fehler hinweg das klärende Gespräch mit der Kollegin zu wagen und dabei merkt, wieviel Befreiung darin stecken kann und Neuanfang.
Die Aufträge sind so verschieden wie unsere Gesichter verschieden sind, und immer führen sie zum anderen, zum Menschen neben mir. Und auf diesem Weg, so weit und so schwer und so unüberwindlich er manchmal erscheinen mag darf jeder dieses unvergleichliche Wort hören: Ich bin mit dir.
Das will gewagt werden.
Der Name Gottes
„Wie ist sein Name?“, so werden die Israeliten ihn fragen, mutmaßt Mose. Wahrscheinlich zu Recht.
Offenbar genügt es Menschen nicht zu sagen: Es gibt einen Gott, an den Väter und Mütter geglaubt haben.
Offenbar reicht es nicht allein, daß sich Gott Müttern und Vätern zu erkennen gegeben hat.
Offenbar hilft es wenig zu sagen: Was den Alten gut war, wird auch für euch gut sein. Es muß wohl noch etwas mehr dazu kommen.
Mose erhält deshalb auf seine Einwände hin ohne Widerspruch diesen „Namen“ Gottes als Antwort. Ein Name, über den heute noch viel gerätselt wird: „Ich werde sein, der ich sein werde.“
Gott verweigert sich nicht und bleibt nicht nur geheimnisvoll, sondern er macht sich mit einem Namen bekannt und läßt sich so ansprechen.
Es ist ein Name, der zwar schwer deutbar ist, aber nun doch in die Zukunft weist, ein Name der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet.
Der erste Monat eines neuen Jahres ist nun schon fast wieder um. Und manchem wird es vorkommen, als sei das Weihnachtsfest schon lange vorbei. Und wir wissen auch nicht, was das Jahr noch mit sich bringen wird.
Heute morgen darf einer, den dabei die Angst befällt das hören: so wie Gott in der Vergangenheit sein Volk herausgeführt hat aus der Not in Ägypten, so wird er auch in Zukunft für Menschen da sein. Gott ist der Herr über die Zeiten. „Ich erweise mich als der Getreue“ sagt der Name in einer anderen Übersetzung.
Wer ist Gott?
Vielleicht merken wir im Blick auf die Erscheinung im Dornbusch, im Auftrag und im Namen Gottes, daß Gott nicht in irgendwelche Formeln paßt. Gott sperrt sich auch gegen die vielen Schablonen, die wir gern bereithalten. Die Geschichte vom brennenden Dornbusch läßt spüren, daß Gott immer auch ein unauslotbares Geheimnis bleibt, ein Geheimnis freilich, das sich seinem Volk zuwendet, den Menschen zuwendet, mir zuwendet. Mit diesem Versprechen können wir unsere Schritte ins Neue Jahr hinein tun wie in ein gutes und weites Land.
Amen.
Gemeinde: Kanon, Jahreslosung
Pfarrerin: Abkündigungen
Gemeinde: EG 70, 5 + 6
Pfarrerin: Fürbittengebet
Gott, Licht und Dunkel, Hoffnungen und Ängste haben wir dir genannt.
Du schenkst uns das Licht des Leben,
wir machen so selten Gebrauch davon.
Wir bitten dich für uns Frauen und Männer,
nicht nur, dass uns ein Licht aufgeht,
wir bitten, dass wir es auch nützen.
Leuchte unsere Wege aus, dass wir nicht in die Irre gehen.
Wir bitten dich für alle,
die kein Land mehr sehen,
die sich nichts zutrauen,
die es schwer mit sich selbst und mit den
Menschen um sich haben,
zeige ihnen Wege aus ihrer Dunkelheit.
Wir bitten für die Menschen in Not,
in Kriegen, für die Menschen auf der Flucht und in Unrechtssystemen,
lass es hell werden auf dieser Erde,
dass sie aufatmen können und endlich
Freude finden am Leben.
Gib uns allen das kostbarste Licht,
das unter uns so spärlich brennt,
gib uns Vertrauen in deine Liebe.
Lass uns spüren, dass du da bist. Amen.
Gemeinde: Abendmahlslied: EG 66, 6-8
Pfarrerin: Gebet:
Gott, du teilst aus, und wir leben davon:
Du gibst Brot, und wir werden satt;
du tränkst uns, und wir leben auf;
du kommst zu uns, und wir sind nicht allein.
Verbunden mit allen Hungrigen
in Jesus, dem Bruder, bitten wir:
Für alle, die hungern nach dem täglichen Brot,
dass unter uns gerechtes Teilen gelingt
und jeder bekommt, was er zum Leben braucht.
Für alle, die hungern nach Gerechtigkeit,
dass ihre Stimme gehört, ihre Arbeit voll bezahlt
und ihre Würde geachtet wird.
Für alle, die hungern nach Liebe,
dass jemand unter uns Zugang findet zu ihrem Herzen und sie herauskommen aus ihrer Einsamkeit.
Gott, du teilst aus, damit wir leben.
Lass uns dankbar empfangen und weitergeben.
Gemeinde: Heilig, heilig, heilig
Pfarrerin und Gemeinde
Gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Pfarrerin: Einsetzungsworte
Unser Herr Jesus Christus,
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach:
Nehmet hin und esset;
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmet hin und trinket alle daraus;
Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, so oft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis.
Gemeinde: Christe, du Lamm Gottes
Austeilung des Mahls:
Wir sind nun eingeladen, das Brot zu essen und den Wein zu trinken und dabei Gemeinschaft zu haben durch unseren Herrn Jesus Christus.
Nimm hin und iss. So spricht der Herr: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.
Nimm hin und trink. So spricht der Herr: Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Worte nach der Austeilung:
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Gebet nach dem Mahl:
Du bist uns nahe gekommen in Brot und Wein. Du hast uns angenommen mit unseren Schwächen und Wunden und hast uns reich gemacht mit deiner Herrlichkeit. Das ist ein Vorgeschmack auf dein Kommen am Ende der Zeit. Dafür danken wir dir, Gott. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Gemeinde: EG 70, 7
Segen:
Geht in diesen Tag, in diese Woche mit dem Segen unseres Gottes.
Gott segne dich und behüte dich,
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Orgelnachspiel