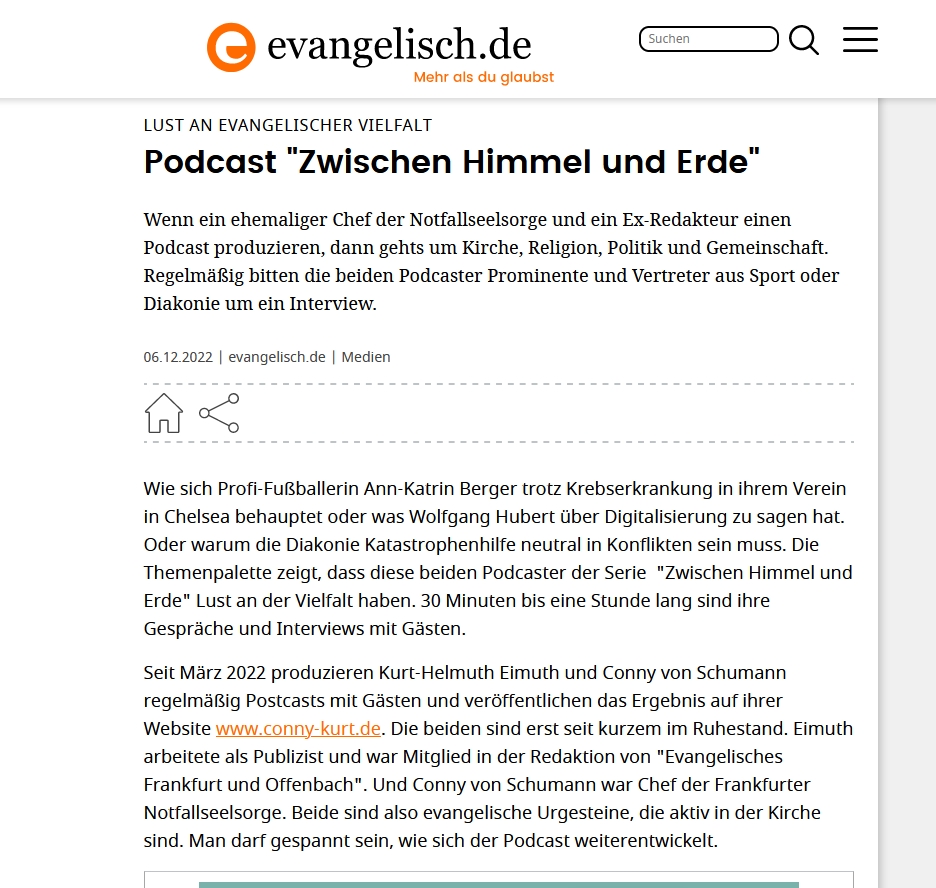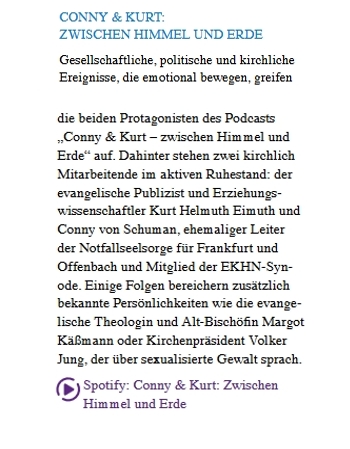Was bringt das neue Jahr? Eine Frage, die gerne spielerisch an Silvester beim Bleigießen beantwortet wird. Wissen, was die Zukunft bringt. Eine uralte Sehnsucht der Menschen, die gerade in Krisenzeiten Konjunktur hat. Alljährlich untersucht die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, Darmstadt, in einem Prognosecheck, ob die Hellseher:innen und Astrolog:innen richtig gelegen haben. Da gibt es manch Absurdes. Das Ende der Rolling Stones, ein Feuer im Schloss Neuschwanstein oder Riesenkaninchen, die eine Stadt angreifen. Und doch boomt der Markt weiter. Bernd Harder von der GWUP im Podcast Conny&Kurt: „Die Astrologie hat in den letzten zwei Jahren einen Aufschwung genommen. In unsicheren Zeiten will man Orientierung. Vielleicht wissen ja die Sterne doch mehr als unsere Wissenschaft.“ Er weist auch auf die Vernetzung der unterschiedlichen esoterischen Szenen mit denen der Verschörungsgläubigen hin: „Bei den festgenommenen Reichsbürgern war eine Astrologin dabei, die Ministerin werden sollte. Es gibt Verbindungen zwischen den Szenen.“ Astrologie kann eben aus mehr werden als eine Spielerei.
Kalte Kirchen sind das falsche Signal
Für Pfarrer Wolfgang Weinrich, Darmstadt, ist Weihnachten „eine Insel der Wärme“. Deshalb sei es gerade jetzt das völlig falsche Signal die Kirchen nicht mehr zu heizen, sagt der Chefredakteur von „Das Magazin für Pfarrer:innen“. Kalte Kirchen seien ein abstoßendes Zeichen. Die versteckte Botschaft sei „am besten bleibt ihr alle weg“. Die evangelische Kirche in Frankfurt hat beispielsweise beschlossen, alle Kirchen der Mainmetropole überhaupt nicht mehr zu heizen. Weinrich fordert vielmehr dazu auf, dass Weihnachtsfest mit großem Geläut und Glühwein in warmen Kirchen zu feiern. Die Menschen sehnen sich nach Festen, hat der Theologe festgestellt. Und bei der Botschaft „Friede auf Erden“ sei zu vermitteln, dass dieser nicht einfach vom Himmel falle. Er habe seinen Preis. Und auch abseits der Ukraine gäbe es Not. Diese Schattenseiten dürfe man nicht vergessen. Er denke immer an das Wort: Das Volk, das im Finstern wandelt, findet ein kleines Licht – immerhin.
Früher war Weihnachten auch nicht besser – nur anders
Die neugierigen Augen der Kinder begleiten die Advents- und Weihnachtszeit. Im Podcast Conny&Kurt erinnern sich die beiden, an ihre Weihnachtskindheit. An Selbstgebasteltes, an das Erstrahlen des Weihnachtsbaum an Heilig Abend und an das verbotene Entleeren der Plätzchendosen. Und natürlich an den Weihnachtsbraten. Da wird so manche Erinnerung wach.
Der Ukrainekrieg ist auch ein Angriff auf uns
Andreas von Schumann kennt die Ukraine gut. Vier Jahre hat der ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Kiew gelebt und im Auftrag der Bundesregierung das Land bei Reformprozessen beraten. Im Podcast Conny&Kurt schildert er seine Erfahrungen, positioniert sich als Kriegsdienstverweigerer klar für die militärische Verteidigung und hofft, dass die Unterstützung nicht nachlässt. Er selbst, der immer noch viele Kontakte in die Ukraine hat, unterstützt Geflüchtete an seinem Heimatort. Sein Fazit: Der Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf uns. Deshalb muss man auch aus ganz rationalen Gründen helfen, wo man kann.
Jugendkrimis gegen Rassismus
Imagine und weitere Popsongs für den Frieden
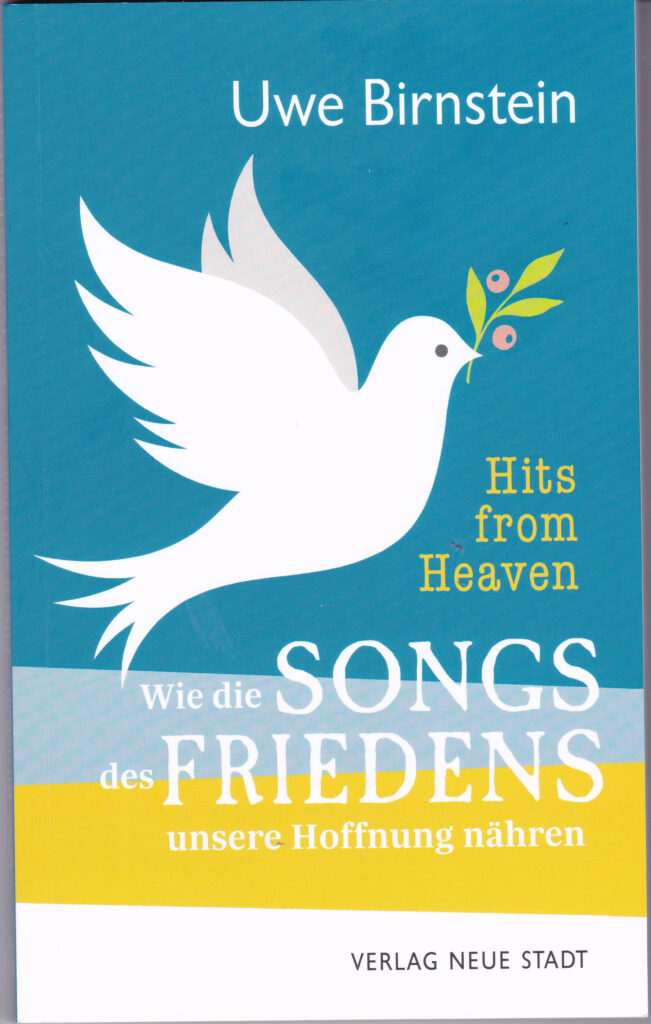
Frieden auf Erden ist der zentrale Wunsch zu Weihnachten. Seit 2000 Jahren ist er aktuell und doch unerfüllt. Die Sehnsucht nach Frieden drückt sich natürlich auch in der Musik aus. Gerade die Popkultur der 1970er- und 1980er Jahre brachte Lieder hervor, die dieses Lebensgefühl wiedergeben. Uwe Birnstein, Journalist, Theologe und Musiker, hat 25 Friedenslieder und ihre Entstehungs- und Wirkungsgeschichten in einem Band vereint. Im Podcast Conny&Kurt erzählt er wie er die Lieder auswählte, lüftet das Geheimnis wie der aktuelle Song von Pink Floyd mit dem uktainischen Sänger Andriy Khlyvnyuk entstand und warum auch Nicole in diese Auswahl gehört.
Die Serie von Uwe Birnstein auf Domradio.de
Humanitäre Hilfe braucht Neutralität
Die Diakonie Katastrophenhilfe
Das Leid ist unbegreiflich. Nicht vorstellbar. 850 Millionen Menschen gehen mit Hunger ins Bett. Das sind zehn Prozent der Weltbevölkerung. 50 Millionen Menschen stehen an der Schwelle zur Hungersnot. Die Hilfsorganisationen helfen, wo sie können. Conny & Kurt haben in ihrem Podcast den Chef der Diakonie Katastrophenhilfe Martin Kessler gefragt wie Hilfe rund um den Globus aussieht, wie die Diakonie arbeitet und ob das gespendete Geld auch wirklich bei den Betroffenen ankommt. Kessler begründet auch, warum es neben Brot für die Welt eine Katastrophenhilfe gibt. Während Brot für die Welt parteiisch sei, sein müsse, da sich die Organisation für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt, müsse die Katastrophenhilfe dagegen streng neutral sein, damit sie auf beiden Seiten in einem Konfliktgebiet humanitäre Hilfe leisten könne. Insofern sei die evangelische Kirche mit dieser Aufteilung gut beraten.
Spendenkonto: Evangelische Bank | IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
Trauerredner:innen gefragt
Kommenden Sonntag ist Ewigkeitssonntag oder wie er im Volksmund genannt wird, Totensonntag. Glauben die Menschen noch an ein Leben nach dem Tod? Nur noch jede:r Zweite wird in den Städten christlich beerdigt. Die andere Hälfte greift meist auf die Dienste der Trauerredner:innen zurück. Conny&Kurt sprachen mit einer. Die Vorbereitung, die Ansprache, die Begleitung der Trauernden unterscheidet sich eben nur in einem von einer evangelischen oder katholischen Beerdigung: Der Trost auf ein Ewigen Lebens fehlt. „Ich frage die Leute, ob sie an Gott glauben“, erzählt Kristin Holighaus. „Manche haben Yoga gemacht, sich mit fernöstlichen Religionen beschäftigt. Dann kommt so ein Mischmasch, den sie Spirituelles nennen“, berichtet die Trauerrednerin, die als Pfarrerstochter gut ihre Kirche kennt. Andere wieder sagen: „Wenn‘s rum ist, ist‘s rum.“ Als Trauerrednerin vermittelt sie die Hoffnung, dass die Liebe bleibt. Ganz wichtig ist für Kristin Holighaus, dass jeder Mensch unterschiedliche Spuren hinterlässt. Er sollte auch so dargestellt werden wie er ist: „Die Trauerfeier ist kein Gerichtssaal und kein Kosmetiksalon“. Warum die Menschen lieber zu ihr als zu einem Geistlichen kommen? „Das ist das Ende eines langen Prozesses. Die Menschen haben die Bindung zur Kirche verloren.“ So der ernüchternde Befund.