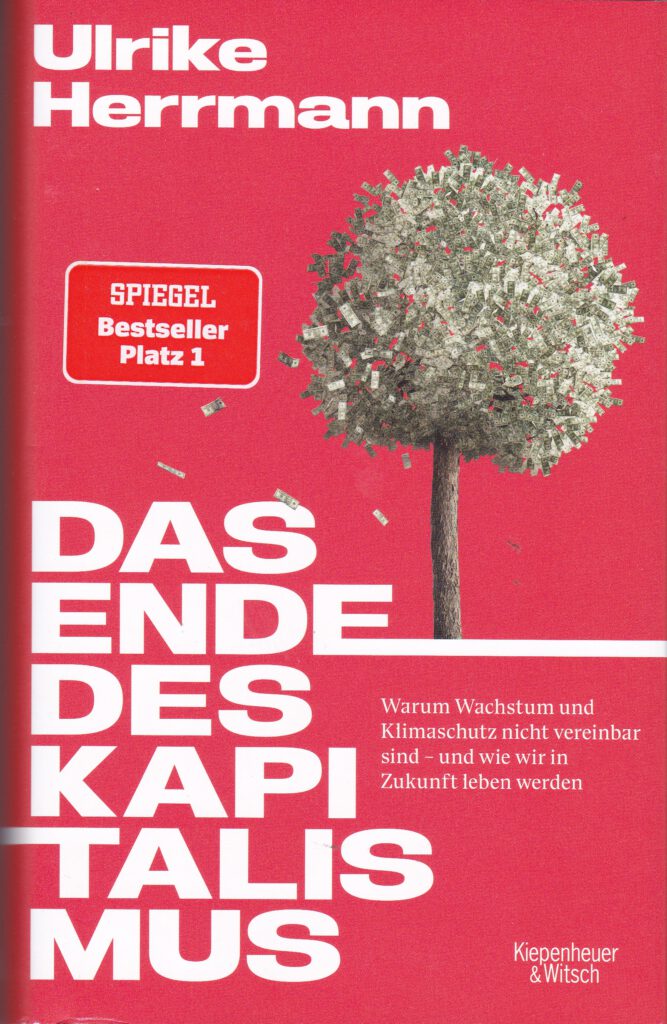Andacht, , 21.5.12
Kurt-Helmuth Eimuth
Lied: EG 319, Die beste Zeit im Jahr
Votum:
Im Namen Gottes kommen wir zusammen.
Gott nimmt uns an, wie wir sind.
Jesus gibt unserem Leben Richtung und Sinn.
Gottes Geist ruft uns auf den richtigen Weg.
Herzlich willkommen allen, die sich haben rufen lassen.
Nehmen wir uns an diesem Wahltag Zeit
für uns, für Gott, miteinander.
Amen
Psalm 27, Nr. 714
Lied: 262, 1-4, Sonne der Gerechtigkeit
Ansprache:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe, auch Sie konnten das für viele verlängerte Wochenende richtig genießen.
Medial war ja Frankfurt an diesen Tagen sehr präsent. Die Kapitalismuskritiker wollten das Finanzzentrum blockieren. Gut, dass alles doch weitgehend friedlich verlief.
Aber gewundert und auch gefreut habe ich mich schon als eine Presseerklärung der evangelischen Kirche in Frankfurt kam, die das Anliegen der Demonstranten unterstützte. Wörtlich heißt es in der Erklärung:
Die evangelische Kirche in Frankfurt tritt ein für die offene Auseinandersetzung über die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Als ChristInnen solidarisieren wir uns mit den Menschen, die unter den massiven sozialen Verwerfungen der Krise, wie z.B. der massiv zunehmenden Armut und der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa zu leiden haben. Vor dem Hintergrund der nach wie vor ungelösten Folgeprobleme auf nationaler wie internationaler Ebene unterstützen wir die Kritik an der ungerechten Lastenverteilung der Krise und fordern eine breite Diskussion um die Zukunft Europas.
Angesichts dieser Herausforderungen braucht unsere Gesellschaft eine starke Zivilgesellschaft. Damit sich diese artikulieren kann, ist sie angewiesen auf die grundrechtlich garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Frankfurt ist geprägt von einem intellektuell offenen und liberalen Geist, der sich gerade unter den Bedingungen verschärfter gesellschaftlicher Auseinandersetzungen bewähren muss.“
Natürlich betont man die Notwendigkeit eines friedlichen Protests. Dass der Kapitalismus nicht einfach das überlegene Gesellschaftssystem ist, dämmert uns langsam. Schon vor Jahren hat Alt-Kanzler Helmut Schmidt vom Haifischkapitalismus gesprochen. Die einst die junge Bonner Republik prägende soziale Verantwortung hat weltweit keine Chance. Die soziale Marktwirtschaft deutscher Prägung kann und konnte sich nicht durchsetzen.
Es ist doch zu fragen, was gerecht ist. In Talkshows wird gerne darüber diskutiert, ob die Höhe der Managergehälter gerecht sind. Sicher ist das Gehalt von BMW-Chef Norbert Reithofer mit gut 6 Millionen für uns schwer nachzuvollziehen. Doch Reithofer gehört zu jenen, die für ihr Geld noch arbeiten müssen. Die Eigentümerin der Firma BMW, die Familie Quandt hat im gleichen Zeitraum mit ihrem Erbe 650 Millionen verdient. Nicht die Arbeitsleistung hat den Reichtum der Besitzenden in neuen Dimensionen katapultiert, nein, es sind die Profite aus den Kapitalgesellschaften. In nackten Zahlen ausgedrückt: Dem reichsten einen Prozent der Deutschen gehören 35,8 Prozent des Vermögens oder andersherum betrachtet. Den ärmeren 90 Prozent gehören gerade einmal 33,4 Prozent des Vermögens.
Reichtum wird nur selten erarbeitet, aber oft ererbt. 80 Prozent der Reichen in Deutschland sind Erben.
Mir fällt bei all dieser Diskussion um ein gerechtes Wirtschaftssystem immer das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ein. Es findet sich im Matthäus Evangelium 20, 1-15
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg zu dingen. Er vereinbarte mit den Arbeitern einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere müßig auf dem Markte stehen und sagte zu denen: „Geht auch ihr in meinen Weinberg, und was recht ist werde ich euch geben.“ Und sie gingen hin. Um die sechste und neunte Stunde ging er noch einmal aus und tat ebenso. Und als er um die elfte Stunde ausging, fand er nochmals andere dastehen und sagte zu ihnen: „Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig?“ Sie antworteten ihm: „Weil niemand uns gedungen hat.“ Da sprach er zu ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg.“ Als es nun Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: „Ruf die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn aus, fange bei den letzten an bis zu den ersten. Und es kamen die von der elften Stunde und erhielten je einen Denar. Als nun die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen. Und auch sie erhielten je einen Denar. Und da sie ihn erhielten, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten: „Diese letzten da haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages getragen haben und die Hitze.“ Er aber erwiderte einem von ihnen und sprach:“Mein Lieber, ich tu dir kein Unrecht. Hast du nicht mit mir einen Denar vereinbart? Nimm das Deine und geh. Ich will aber diesem letzten geben wie dir. Oder darf ich mit dem Meinen nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?“
Nun mahnen alle Kommentare, dieses Gleichnis nicht einfach auf heute zu übertragen. Die Verhältnisse damals waren andere.
In Malaria-Gebieten setzen Gutsbesitzer Tagelöhner ein. Der wirtschaftlich denkende Arbeitgeber bedient sich nicht seiner Sklavinnen und Sklaven, denn diese hat er kaufen müssen. Sie sind für ihn zu wertvoll. Die Tagelöhner aber sind von Geburt her Freie, und doch sind ihre Lebensbedingungen noch elender als die der Sklavinnen und Sklaven. Jesus und seine Anhängerschaft kennen die Arbeitsbedingungen der Tagelöhner sehr genau. Vermutlich gehörten einige von ihnen selbst dazu.
Das Gleichnis selbst beachtet alle Details, die wichtig sind. Der Gutsbesitzer schließt zunächst einen üblichen Arbeitsvertrag mit Handschlag ab, nennt dabei auch die Lohnsumme. Der eine Denar, so setzt der Text stillschweigend voraus, ist so etwas wie das Existenzminimum. Die Neutestamentlerin Luise Schottroff fragt an dieser Stelle berechtigt, ob der Tagelöhner von diesem einen Denar auch Frau und Kinder mit ernähren kann. Wir wissen es nicht. Der Text sagt darüber nichts.
Der Arbeitgeber stellt dann im Laufe des Tages weitere Tagelöhner ein, um 9, 12, 15 und 17 Uhr. Die zuletzt Angeheuerten dürften nur noch gut eine Stunde bis zum Sonnenuntergang zu arbeiten gehabt haben. Der Arbeitgeber zahlt allen den vollen Tagelohn, unabhängig wie lange sie gearbeitet haben. Er sieht, dass auch die Arbeitslosen, die nur noch eine Stunde gearbeitet haben, den einen Denar zum Überleben brauchen. Der Gutsbesitzer richtet sich bei der Auszahlung des Lohnes nicht nach der Leistung sondern nach den Bedürfnissen der Menschen. Die Langarbeiter protestieren. Sie haben kein Verständnis. Das Gleichnis endet offen mit der wortlosen Einladung des Arbeitsherrn an die Langarbeiter, ihr Herz zu öffnen und den Arbeitslosen den Überlebensdenar zu gönnen.
Da liegt einem förmlich die Analogie mit Griechenland auf der Zunge. Öffnen wir unser Herz und gönnen den Griechen den Überlebenseuro, möchte man sagen. Nur leider sind wir nicht mehr bei der Feldarbeit. Die Finanzmärkte funktionieren anders als der Ackerbau. Und doch hat uns das Gleichnis auch heute noch etwas zu sagen. Luise Schottroff formuliert es so:
„Das Gleichnis öffnet Raum für den Gedanken, dass Veränderung möglich ist. Der Arbeitsherr verändert seine Orientierung am Profit, und die Langarbeiter werden zur Solidarität eingeladen. Das Gleichnis ist sparsam mit Anweisungen für Konsequenzen, die zu ziehen wären. Es setzt voraus, dass diejenigen, die diesen Text erzählen und hören, miteinander einen Weg finden, Gerechtigkeit in kleinen Schritten aufzubauen.“ Wir alle müssen uns da einmischen, müssen nach Wegen suchen, denn es betrifft uns alle. Deshalb ist es auch gut, dass die evangelische Kirche am Wochenende ihre Stimme erhoben hat.
Lied: EG: 262, 5 – 7,
Mitteilungen:
Geburtstage
Gebet:
Lassen Sie uns mit den Worten beten, die Dom Helder Camara formulierte: Gott wir müssen in unser Gebet die ganze Menschheit miteinbeziehen,
denn dein göttlicher Sohn, unser Bruder Jesus Christus,
hat sein Blut vergossen für alle Menschen, an allen Orten, zu allen Zeiten.
Trotzdem erlaube uns, Herr, heute ein besonderes Gebet
für die Völker der Welt, die keine Stimme haben.
Es gibt hunderte Millionen Menschen,
wahrscheinlich sogar Milliarden Menschen,
in den armen Ländern und in den Armenvierteln der reichen Länder,
die kein Recht haben, ihre Stimmen zu erheben,
die keinerlei Möglichkeit haben, Einspruch zu erheben und zu protestieren,
so gerecht ihre Sache auch ist, die sie verteidigen wollen. Die Menschen ohne ein Dach, ohne Nahrung, ohne Kleidung, ohne Gesundheit, ohne die geringste Bildungsmöglichkeit, ohne Arbeit, ohne Zukunft, ohne Hoffnung,
sind in Gefahr, dem Fatalismus zu verfallen;
ihr Mut versinkt, ihre Stimme versagt, sie werden zu Menschen ohne Stimme.
Sende, Herr, deinen Geist!
Er allein kann das Angesicht der Erde erneuern!
Er allein wird die Egoismen zerbrechen;
denn das ist unerlässlich, wenn die Strukturen, die Millionen in Sklaverei halten,
überwunden werden sollen.
Er allein wird uns helfen, eine Welt zu errichten, die menschlicher, christlicher ist.
Dass wir, Vater, jedes Mal mehr eins seien mit deinem Sohn!
Dass Christus sehe durch unsere Augen, höre durch unsere Ohren, rede durch unsere Lippen. Text nach: Dom Helder Camara, in: Beten im Alltag, Frankfurt 1995
Und was uns noch bewegt, bringen wir vor dich mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Segen:
Geht in diesen Tag, in diese Woche mit dem Frieden
unseres Gottes:
Der Herr segne dich und behüte dich,
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und
gebe dir Frieden. Amen.
Lied: EG 640, Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen