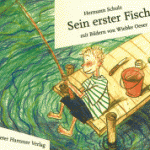Andacht, 6. 9. 2010
St. Peterskirche, Frankfurt
Kurt-Helmuth Eimuth
Heiliggeistkirche
Orgel
Lied: EG 447, 1-3,7 Lobet den Herren
Votum:
Im Namen Gottes kommen wir zusammen
Gott nimmt uns an, wie wir sind.
Jesus gibt unserem Leben Richtung und Sinn.
Gottes Geist ruft uns auf den richtigen Weg. Amen.
Morgengebet: Nr. 815
Luthers Morgensegen
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,
und bitte dich,
du wollest mich diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele
und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
Amen.
Lied: EG 124, 1-4 Nun bitten wir den heiligen Geist
Ansprache:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich weiß ja nicht, was Sie von Gartenzwergen halten. Für mich sind sie ehrlich gesagt stark gewöhnungsbedürftig.
Ja, sicher, Gartenzwerge kommen heute in allerlei Gestalt daher. Als Bundeskanzler, als Eintracht-Fan und nun gibt es auch Lutherzwerge. Erstmals seit dem 19. Jahrhundert zeigt sich der Marktplatz von Wittenberg ohne die Denkmäler der beiden berühmten Reformatoren Luther und Melanchthon – dafür mit 800 Lutherzwergen.
Die Standbilder von Luther (1483-1546) und Melanchthon (1497-1560) sind für eine umfassende Restaurierung abgebaut worden. Der Berliner Kaiser, Friedrich Wilhelm III., hatte damals die Aufstellung angeordnet, auch zum größeren Ruhme seiner Kirche, getragen vom Bündnis von „Thron und Altar.“ Und überall in deutschen Landen entstanden im 19. Jahrhundert die mächtigen Luther-Denkmäler: 1868 wurde das Lutherdenkmal in Worms, wo Luther 1521 vor dem Reichstag stand, enthüllt, das größte Reformationsdenkmal der Welt von Ernst Rietschel steht vor der Frauenkirche in Dresden um nur zwei zu nennen.
In Wittenberg traten die Miniaturfiguren des Reformators Luthers an die Stelle des großen Vorbilds. Sie sollen zum Nachdenken über die Reformation anregen, im Vorfeld der großen Reformationsfeier aus Anlass des Thesenanschlags im Jahre 1517.
Der Nürnberger Künstler Ottmar Hörl hat sie in den Farben rot, schwarz, grün und blau in Wittenberg aufstellen lassen. Hörl sagte, er wolle mit seinen Figuren „einen Impuls setzen und den Menschen ihren persönlichen Luther mitgeben, mit dem sie sich dann individuell, undogmatisch auseinandersetzen können“. Die Kunststofffigur hat wie die Denkmalvorlage eine Bibel in der Hand und ist einen Meter hoch. „Luther hat sich immer ganz klein gemacht“, behauptet Hörl. Der Kunstprofessor stellt gerne kleine Produkte her. 2003 hat er ganz viele kleine Dürer-Hasen auf dem Nürnberger Hauptmarkt aufgestellt, 2004 zur Olympiade kamen 10.000 Eulen nach Athen und in Bayreuth Wagner-Hunde auf die Parkbänke, dann – ebenfalls provozierend – in Straubing 1.250 Nazigarten-Zwerge mit dem sogenannten „deutschen Gruß“ der NS-Zeit.
Die „Lutherzwerge“ genannten Figuren sind umstritten. So bezeichnete der evangelische Theologe Friedrich Schorlemmer die Figuren als „Plaste-Luther“ in rot, grün und blau, die „einfach nur peinlich“ seien. Wortgewaltig wie Luther und ebenso bissig schlägt Schorlemer vor, einen Schlitz zum Geldeinwurf in die Zwerge zu schneiden: »Wenn das Geld im Köpfchen klingt, Luther aus dem Zwerglein springt.« Wirft man 50 Cent rein, predigt er gegen die Vogelfänger. Wirft man einen Euro rein, so liest er einen lieben Brief an Herrn Käthe. Für zwei Euro wütet er gegen Papst, Juden und Türken. Für zehn Euro hört man ein Gleichnis auf unsere Gegenwart: »Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat.« Und weiter schreibt Schorlemmer in der Zeit:
„Deprimiert schaut er drein; aus so einem traurigen Zwerg kommt kein fröhlicher Furz.“… Und das Fazit des ehemaligen Direktors der Evangelischen Akademie in Wittenberg und Bürgerrechtlers: “Gegen Ablasshandel half noch Thesenanschlag. Gegen Kulturmarketing hilft nicht einmal Beten. Ach, verehrter Bruder Martinus, du »alter stinkender Madensack«, du frommer, mutiger, begnadeter Prediger, du anrührender Beter und maßlos Schimpfender, hilf mir schimpfen!“
500 Jahre nach dem Thesenanschlag, der als Beginn der Luther-Reformation gilt, hat sich in der evangelischen Kirche in Deutschland einiges verändert. Im Laden der EKD gibt es nicht nur Aufkleber und Poster zur Lutherdekade, sondern auch Lutherkeks, Luthertaschen und einen Stempel zu Lutherdekade. Die EKD nennt diese Zwerge, die man für 250 Euro käuflich erwerben kann – signiert 500 Euro – „Luther-Botschafter“, die protestantische Inhalte vermitteln und zur Auseinandersetzung mit dem Reformator anregen sollen.
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, hatte Jesus denen gesagt, die ihm nachfolgen und denken wollten wie er (Mt 7,16). „Die Multiplizierung schafft eine Präsenz, die Martin Luther und der Auslegung seiner Lehre gerecht wird. Sie steht als Anregung und soll zu einer ganz persönlichen und undogmatischen Auseinandersetzung führen, “ meint Professor Ottmar Hörl.
Die Organisatoren wehren sich gegen die Kritik. Die Lutherzwerge sollen auf das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 hinweisen und als „Botschafter“ die Lehre von Martin Luther „in die Welt tragen“. Luther gehöre in den Alltag, daran sollen und werden die Figuren erinnern. Sie könnten ein Stachel sein, wenn die reformatorischen Ideen von vor 500 Jahren auf die Realität heute prallen.
Luther selbst war ja davon überzeugt, dass man verständlich für die Menschen sein muss oder wie er es drastisch sagte, dem Volk aufs Maul zu schauen habe.
Im seinem berühmten Sendbrief vom Dolmetschen (1530) hat Luther die Prinzipien seiner Bibelübersetzung eindrucksvoll dargelegt und verteidigt. Er schreibt u. a.:
»man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen, wie man sol Deutsch reden, wie diese esel thun, sondern, man mus die mutter jhm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mit jn redet.«
Deutsch mit ihnen reden Was bedeutet das in einer Mediengesellschaft? Was bedeutet dies für eine Kirche, die nicht mehr Volkskirche ist?
Muss man sich da nicht die medialen Gewohnheiten der Adressaten zu Nutze machen? Nur so kann man den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche sein, wie es einst Paulus forderte.
Wir stehen hier in der Peterskirche. Sie wird genutzt als Jugendkulturkirche. Dies ist genau so eine Übersetzungsarbeit. Vor über 500 Jahren wurde die erste Peterskirche als Kapelle hier nebenan gebaut, weil die Menschen nicht so weit zum täglichen Gebet vom Feld kommend laufen wollten. Heute müssen wir andere Formen finden, um etwas von der Botschaft weiterzugeben.
Und auch wir liebe Kolleginnen und Kollegen sind ja auch in unserer Arbeit täglich Botschafteinnen und Botschafter eben dieses einen Gottes. Lassen Sie uns darum bitten, dass wir stets den richtigen Ton treffen und verstanden werden.
Lied: EG, 362, 1, 2 +4 Ein feste Burg ist unser Gott
Mitteilungen:
Gebet:
Wir bitten dich, Gott, für unsere Kirche
Hilf, dass sie zu einem Ort wird,
an dem dein Wort und deine Liebe lebendig werden.
Wir bitten dich für das Miteinander der Völker.
Lass nicht zu, dass Misstrauen und Ungerechtigkeit
unsere Welt spalten.
Wir denken an die Schwachen und Kranken.
Hilf ihnen, dass sie sich ihrer besonderen Stärken bewusst werden.
Schenke uns Geduld miteinander.
Wir bitten dich, Gott, für alle,
die in Kirche und Gesellschaft kritisch ihre Stimme erheben.
Hilf ihnen, dass sie nicht zerrieben werden.
Lass sie für uns zu einem bleibenden Stachel werden.
Wir bitten für uns selbst.
Dass wir weder falschen Idealen nachlaufen noch resignieren.
Gib uns Ahnungen von deinem Weg und stärke uns für ihn.
Mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, beten wir:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib unsheute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Segen:
Geht in diesen Tag, in diese Woche mit dem Segen unseres Gottes:
Gott, segne uns und behüte uns
Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung.
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns,
dass wir leuchten für andere.
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest
im Glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod. Amen.
Lied: EG 421, Verleih uns Frieden