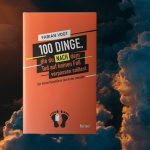Abschied von Steinperf
Obgleich Frankfurter kam ich 1978 in eine hessische Gegend, die mir bisher verborgen geblieben war. Ich erinnere mich noch genau. Meine damalige Freundin zeigte mir wie die Kurven sportlich zu fahren waren und ich staunte in den Sitz des Audi 50 gepresst über eine Landschaft, die mich an Österreich mit seinen Wiesen und Wäldern erinnerte. Nur die Berge waren niedriger. Und dann die Sprache. Ich lernte, dass es nicht einfach nur Hessisch gibt. Der Sprachraum in Mittelhessen, im hessischen Hinterland, ist ein ganz eigener. Die ersten drei Tage verstand ich wenig bis nichts. 
Doch
im Laufe der Jahrzehnte habe ich mich eingehört, verstehe 98
Prozent, Platt schwätzen heute auch nur noch die alten Leute, zu
denen meine Generation gehört. Das Leben im kleinen Dorf Steinperf
im Altkreis Biedenkopf habe ich lieben und schätzen gelernt. Und nun
gilt es Abschied zu nehmen. Die Schwiegereltern sind lange verstorben
und auch wir können das Haus, das wir zwischenzeitlich für uns
ausgebaut haben, nicht mehr nutzen. Es ist nicht barrierefrei und nur
mit hohem Aufwand umzubauen. Ein Ausschlusskriterium, da meine Frau,
jene Dame, die mich so flott ins Hinterland beförderte, seit vier
Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Hinzu
kommt die medizinische Versorgung auf dem Land. Die Arztpraxen in den
umliegenden Dörfern schließen nach und nach. Der öffentliche
Nahverkehr findet praktisch nicht statt und von schnellem Internet
darf man träumen. Alles Argumente, die uns schon vor vielen Jahren
von unserem ursprünglichen Plan, im Ruhestand ganz aufs Land zu
ziehen, abbrachten. Und noch eines sollten die bedenken, die für die
Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens verantwortlich sind. Immer
nur neue Wohnungen zu bauen, obgleich die Bevölkerung schrumpft,
kann nicht die einzige Antwort sein. Auch im Hinterland, gut
einhundert Kilometer von Frankfurt entfernt, stehen in jedem Dorf
zehn Häuser leer. Für eine Drei-Zimmer-Wohnung in Frankfurt bekommt
man dort fünf Häuser. Die Mieten liegen entsprechend weit unter
dem, was in Frankfurt eine geförderte Wohnung kostet. Die Förderung
des ländlichen Raums hätte mindestens so viel Aufmerksamkeit
verdient wie die explodierenden Mieten in den Ballungszentren.
Aber
wir können nicht mehr so lange warten bis die Politik den Trend
wendet. Das Haus muss geräumt werden. Jedes Buch, jeder Schrank hat
seine Geschichte. So wie das Gebäude selbst. Meine Schwiegermutter
hatte es per Los zugesprochen bekommen. So wie man sich das
vorstellt: Mit langen und kurzen Streichhölzern. Sie zog das Lange
und ihre Brüder hatten das Nachsehen. Das 1900 erbaute Fachwerkhaus
fiel ihr zu und die Brüder mussten ausgezahlt werden. Das war Anfang
der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ein Drittel des Hauses war
Scheune, im Keller war ein kleiner Stall in dem eine Kuh gehalten
wurde. Gemeinsam mit der Bewirtschaftung eines Ackers und eines
Gartens trug diese Mini-Nebenerwerbs-landwirtschaft erheblich zum
Unterhalt der Familie bei. Auch ich Stadtkind half dann später bei
der Kartoffelernte und durfte auch mal Traktor fahren. Schönes
Landleben, wenn auch der Rücken schmerzte.
Vor
diesem Hintergrund kann man den Stolz nachvollziehen, wenn die
Schwiegermutter vom Kauf des Küchenbuffet erzählt. Lange hatten sie
sparen müssen. Der Dorfschreiner hat es in Handarbeit hergestellt.
Die Schütten für Mehl und Zucker sind noch vorhanden. Dank der
liebevollen Behandlung mit Möbelpolitur ist der Schrank noch gut
erhalten. Längst ist er in den Keller gewandert. Fristete dort ein
vernachlässigtes Dasein, wurde zweckentfremdet zur Aufbewahrung von
Bastelmaterialien und ja, nicht verbrauchte
Spielzeugeisenbahnutensilien hatte ich dort gelagert. Jetzt muss auch
dieser Schrank entsorgt werden. Gut, dass die Schwiegermutter dies
nicht mehr miterlebt.
Ein
Freund kam während des Räumens vorbei und meinte. Auch er müsse
mal mit seiner Frau das Haus räumen. Schließlich könne man das
nicht den Kindern überlassen. Aber vom Gefühl könne er sich nicht
vorstellen, alles wegzuwerfen. Mein Rat: „Tu dir das nicht an.
Vererbe etwas Geld mit dem die Kinder den Entrümpler bezahlen
können. Dann ist alles gut.“
Verschwiegen
habe ich, dass das Wegwerfen nicht das Problem ist. Das Aussortieren
ist das Problem. Welche Erinnerungsstücke möchte ich noch behalten.
Wo habe ich Erinnerungen, was hat für mich einen ideellen Wert?
Klar, Fotos wirft man nicht weg. Die Fotoalben finden sicher irgendwo
einen neuen Platz. Auch die kleine Plastiktüte mit Bildern aus dem
Krieg, die noch im Wohnzimmerschrank lag. Mein Schwiegervater stolz
in Uniform. Er, den ich nur als eingefleischten Sozialdemokraten
kannte. Brief-markengroße Bilder von fremden Landschaften,
vermutlich Frankreich. Und Gruppenbilder wie wir sie heute auch
machen. Nur eben eine Gruppe Soldaten. Auch das alte Soldbuch fand
sich noch. Mit deutscher Gründlichkeit ist alles festgehalten, etwa
auch ob Feldmütze, Drillichzeug, Unterhose oder Mantel an den
Gefreiten ausgegeben wurde. Genau Buch geführt wurde auch über das
Aushändigen einer Gasmaske. Und schließlich die Eintragungen des
Lazaretts im Jahre 1944. Wie so viele seiner Generation sprach auch
mein Schwiegervater nicht über seine Kriegserlebnisse. Wir hatten es
gelegentlich versucht. Lungensteckschuss, Lazarett,
Kriegsgefangen-schaft. Alles kein Zuckerschlecken. Viele Fragen
bleiben unbeantwortet. Und dann nach dem Krieg Schleifarbeiten im
Metallgewerbe. Ergebnis Staublunge. Bei allem, was die EU
kritikwürdig macht, sind über sieben Jahrzehnte Frieden ein
Geschenk für unsere Generation.
Zu den schöneren Funden gehört ein grauer Karton mit Briefen. Vor allem die Glückwünsche zu unserer Hochzeit vor 38 Jahren, aber auch einige Briefe, die wir uns geschrieben haben. Vergessen, verstaut im Trempel des Dachgeschosses. Viele, von denen, die uns gratulierten, sind nicht mehr unter uns. Es gilt der Satz von Sören Kierkegaard: „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“
Vergessen, verstaut im Trempel des Dachgeschosses. Viele, von denen, die uns gratulierten, sind nicht mehr unter uns. Es gilt der Satz von Sören Kierkegaard: „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“
Jeder
Haushalt hat Geschirr. Die beiden Haushalte, unserer und der der
Schwiegereltern, hatten unvorstellbare Mengen von Geschirr.
Schließlich brauchte man auch für Geburtstagsfeiern jede Menge.
Normale Geburtstage, keine Runden. Da wurde schon drei Tage vorher
mit dem Backen begonnen, Tische und Stühle wurden herbeigeschleppt,
das Wohnzimmer umgeräumt. Meine ungläubige Frage, wer denn alles
eingeladen sei, entgegnete man mit einem unverständlichen Schweigen.
Also schleppte ich mit, deckte Tische. So dreißig Personen waren
unterzubringen. Und tatsächlich. Pünktlich um 15 Uhr war das
Wohnzimmer mit Nachbarn, Freundinnen und Freunde und Verwandtschaft
gefüllt. Auf jedem Tisch standen drei Torten und den Kaffee durften
wir Kinder einschenken. Bedienung gehörte dazu. Kein Wunder also,
dass hier Ess- und Kaffeeservices jeweils für 18 Personen in den
Schränken gestapelt waren. Hinzu die zahllosen Kuchenplatten aus
Bleikristall oder auch einfach Tupper für den Transport, denn
schließlich bekam jede Familie noch etwas vom Geburtstagskuchen mit
nach Hause.
Jetzt
will niemand das Geschirr mehr haben. Selbst auf eBay erzielt es
keine nennenswerte Nachfrage mehr. Man merkt, wir sind die Generation
der Erben. Demografischer Wandel einmal ganz praktisch. So bleibt für
Vieles nur noch der Restmüllcontainer.
Nachbarschaft
ist auf den Dörfern etwas Besonderes. Es sind nicht nur Nachbarn,
die sich Jahrzehnte kennen. Sondern auch die Generation davor und die
Generation danach leben in der Dorfgemeinschaft. Man besucht sich,
nimmt Anteil und übt natürlich auch soziale Kontrolle aus. „Du
musst die Vorhänge waschen, man spricht schon darüber“, war der
in einem Brief gefundene Ratschlag meiner Schwiegermutter.
Damit
doch noch etwas Nachhaltigkeit erzielt wird, haben wir einen
Hausflohmarkt veranstaltet. Mit mäßigem Erfolg. Auch da zeigt sich
das Landleben negativ. Vieles hätte in Frankfurt seinen Abnehmer
gefunden, doch wer will schon für gebrauchte Möbel, Geschirr und
Haushaltsutensilien viele Kilometer fahren? Und die Zeitgenossen, die
dann anrufen und fragen, ob man die geschenkte Couch nicht doch
vorbeibringen könne, sind leider gar nicht so selten. Die, die
flehentlich um die Reservierung des Tisches oder der Bank gebeten
haben, erscheinen dann häufig nicht. Verbindlichkeit fehl am Platze.
Zu
den ideellen Werten gehören immer Dinge, die selbst hergestellt
wurden. Da sind die Intarsienarbeiten des Schwiegervaters, ob als
Bild oder als Verschönerung der Möbeltüren. Oder die Kommode, die
er für seine Enkelin in der Tradition naiver Bauernmalerei gestaltet
hat. Natürlich werden solche Objekte sorgfältig verpackt und
eingelagert. Auch die alte Bandonika, eine Art Akkordeon, gehört
dazu. Überhaupt war der Schwiegervater ein begabter Künstler.
Musik und Malerei waren seine Passion.
Bücher sind der Schreck eines jeden Möbelträgers. Wohin? Und warum nicht aufheben? Diesen Krimi wollte auch ich noch lesen und der Band über Masuren diente immerhin zur Vorbereitung einer wunderbaren Fahrradtour. Und was mache ich mit den Fachbüchern? Brauche ich sie trotz Internet nicht doch noch einmal zum Nachschlagen? Es hilft nichts. Für die allermeisten bleibt nur die Papiertonne.
Und wie überall wurde am Haus ständig gewerkelt. Den Einbau einer Zentralheizung, den Bau eines Zimmers in die Scheune, den Bau einer Garage waren die kleinen Projekte. Beim Bau der Garage konnte ich dem 1991 verstorbenen Schwiegervater helfen. Ob Maurerkellen oder Zollstocksammlung, alles von Schwiegervater Otto. Immer wieder erschall beim Ausräumen der Ruf: „Oh, das ist noch von Otto“. Schließlich die Frage eines helfenden Freundes: „Wer war denn dieser Otto?“ In der Erinnerung leben wir weiter. Und das ist doch schön.
Kurt-Helmuth
Eimuth, Juni 2019






 Vergessen, verstaut im Trempel des Dachgeschosses. Viele, von denen, die uns gratulierten, sind nicht mehr unter uns. Es gilt der Satz von Sören Kierkegaard: „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“
Vergessen, verstaut im Trempel des Dachgeschosses. Viele, von denen, die uns gratulierten, sind nicht mehr unter uns. Es gilt der Satz von Sören Kierkegaard: „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“