Würdigung von Marion Eimuth durch Schulamtsdirektor Jan Schäfer
Liebe Marion Eimuth,
in diesem Gottesdienst verschieden wir Sie aus Ihrem aktiven Dienst als Pfarrerin in den Ruhestand.
Vor einigen Wochen haben wir uns getroffen, um diesen Gottesdienst zusammen vorzubereiten. Ich bin dankbar für unsere Begegnung. Zusammen mit ihrem Mann und Pfarrer Thorsten Peters haben wir auf ihren Berufsweg zurückgeblickt.

Schulamtsdirektor i.K. Pfarrer Jan Schäfer in der Gethsemanekirche bei der Entpflichttung von Marion Eimuth
Wir
haben einige Male miteinander Tränen vergossen. Weil es eben ganz besondere Umstände sind. Das wissen alle. Und, dass Sie sich diesen Übergang sicher ganz anders gewünscht hätten. Aber, wir haben auch zusammen gelacht. Beides liegt eng zusammen: Das betrübt sein und die Dankbarkeit und die Freude.
Dass wir hier in der Gethsemanekirche sind, ist stimmig. Seit Jahrzehnten ist das Ihre Heimatgemeinde. Hier waren Sie lange Jahre Kirchenvorsteherin und Mitglied im Chor. Hier im Stadtteil leben Sie seit vielen Jahren.
Ihr beruflicher Weg als Pfarrerin war ganz sicher kein typischer Weg in das Pfarramt. Aber ein interessanter und spannender Weg, der Ihrer Persönlichkeit sehr entspricht.
Bei unserem Gespräch bei Ihnen zu Hause habe ich durch Sie und durch Ihren Mann vieles von Ihnen neu erfahren. Obwohl wir im Schuldienst ja einige Jahre Kollegen waren.
Sie stammen aus dem Hessischen Hinterland. Ganz genau aus dem Ort Steinperf in der Nähe von Biedenkopf. Das haben Sie mit Pfarrer Peters gemeinsam. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Menschen dort eher fromm und gottesfürchtig sind.
Sie haben die Handelsschule besucht und dann zunächst etwas Richtiges gelernt. Nämlich den Beruf der Buchhalterin und in diesem Beruf dann noch ein Jahr gearbeitet.
Mit 18 Jahren sind sie von Steinperf weggegangen, nach Darmstadt. Sie sind in eine Frauen-WG gezogen und haben an der Evangelischen Fachhochschule das Studium der Gemeindepädagogik begonnen.
Ihr Anerkennungsjahr haben Sie im Frankfurter Stadtjugendpfarramt geleistet – 1976/77, da waren Sie 22 Jahre alt. Das war – vor allem der Ort „Stadtjugendpfarramt“ – eine wichtige Entscheidung, wegweisend für Ihr weiteres Leben. Denn dort sind Sie Kurt-Helmuth Eimuth begegnet. Der Beginn einer lebenslangen Liebe.
Ihre erste Stelle als Gemeindepädagogin hatten Sie in der St. Katharinengemeinde. In dieser Gemeinde haben Sie für sich das entdeckt, was wir heute neu-theologisch gern theologisieren nennen. Theologische Fragen haben Sie mehr und mehr interessiert. Vielleicht auch, weil Sie mit den Antworten der damals männlichen Pfarrkollegen oftmals eher unglücklich und unzufrieden waren.
Also haben Sie nach 2 Jahren in der Gemeinde entschieden: ‚Ich studiere Theologie!‘. Hebräisch und Griechisch haben Sie zusammen mit Ihrem Mann in Frankfurt gelernt. Dann sind Sie für 2 Semester nach Heidelberg und schließlich nach Mainz.
Dazwischen haben Sie 1981 geheiratet. 1983 kann Ihre Tochter Anne-Elisabeth zur Welt. 1989 haben Sie das erste Examen abgelegt und anschließend Ihr Vikariat in der Gemeinde Cantate Domino bei Pfarrer Hermann Düringer. Daran schloss sich ein Spezial-Vikariat im Pfarramt für Frauenarbeit an.
1994 sind Sie zum Diakonischen Werk der EKHN gegangen, als theologische Referentin. 1996 wurden Sie auf dieser Stelle als Pfarrerin ordiniert und beim DW bis 2002 tätig.
Und dann, 2002, noch einmal eine berufliche Weiterentwicklung. Jetzt in Richtung Schule. Mit Beginn des Schuljahres 2002/2003 wurden Sie Pfarrerin im Schuldienst, an der Georg-Kerchensteiner-Schule in Obertshausen.
Die Arbeit an der Schule, vor allen mit den jungen Erwachsenen im Übergang in den Beruf, bei den ersten Schritten in ein selbstständiges Leben, hat Ihnen große Freude gemacht.
Hier waren Sie als Pfarrerin und Seelsorgerin an der richtigen Stelle. Auch wenn Sie offiziell keinen Auftrag zur Seelsorge hatten, haben Sie sich immer als Seelsorgerin an der Schule verstanden.
Und die Mädchen und Jungen und Frauen und Männer an der Schule haben Ihren Rat und das Gespräch mit Ihnen als Seelsorgerin dankbar gesucht. Sie waren froh, dass Sie da waren.
Meistens haben Sie nicht nur die Evangelischen unterrichtet, sondern die ganze Klasse. Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen sozialen Milieus, mit und ohne Glauben an Gott.
Auf einem wichtigen Lebensabschnitt haben Sie Ihnen das Angebot gemacht, über die existenziellen Fragen des Lebens zu sprechen.
Die Schule hat zu Ihnen gepasst, und Sie zur Schule. Daneben haben Sie sich im Dekanat Rodgau engagiert: Sie waren Mitglied des Dekanatssynodalvorstandes und in der Synode. Und weiter auch hier in Ihrer Gemeinde in Frankfurt aktiv, z. B. auch beim Feiern von Gottesdiensten.
Lange Jahre haben Sie junge Menschen bei Ihren existentiellen Fragen begleitet – und auf einmal – quasi aus heiterem Himmel – brach die Frage nach dem Leben, und nach dem was Leben ausmacht, in Ihr eigenes Leben. Im August 2015 traf Sie ein Schlaganfall. Ihr Leben veränderte sich von einem Tag auf den anderen. Für Sie, für Ihren Mann, Ihre Familie, Ihre Freunde war alles anders.
In den vergangenen 2 ½ Jahren haben Sie einen schweren Weg zurückgelegt. Mit Hilfe, mit Unterstützung und mit Liebe sind Sie ihn gegangen und haben sich Stück für Stück ins Leben zurückgekämpft. Und vielleicht kommt es auch Ihnen manchmal wie ein kleines Wunder vor, dass Sie bei all dem Schweren und Belastenden heute hier mit uns allen Gottesdienst feiern.
Heute werde Sie von allen dienstlichen Aufgaben entbunden. Und damit verbunden feiern wir Sie, liebe Marion Eimuth.
Und sagen – und das tue ich aus tiefstem Herzen – danke! Dank für all das, wie Sie durch Ihre Gaben und Fähigkeiten vielen, vielen anderen Menschen Freude und Lebensmut schenken konnten.
Anderen haben Sie die Gewissheit gegeben, nicht allein im Leben zu stehen, sondern sich getragen zu fühlen. Das durften auch Sie erleben – ganz besonders in den vergangenen 2 Jahren – und ganz sicher auch in der Zukunft. Liebende Menschen tragen Sie!
Ich möchte Ihnen deshalb ein Wort aus dem Alten Testament zusprechen. Es drückt diesen Gedanken der Bewahrung und des Getragen- und Gehaltenwerdens aus. Ein Wort, das Mut macht und das davon spricht, dass Gott uns nicht fallen lässt. Nicht in guten Zeiten und nicht in schweren Zeiten.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. (Psalm 139.9.10)
Liebe Marion Eimuth, bleiben Sie von Gott geführt und in ihm gehalten. Amen.
Verabschiedungsteil/ Ruhestandsversetzung
(Verantwortlich: Jan)
(Jan bittet Marion Eimuth nach vorn)
Liebe Marion Eimuth,
Du hast 21 Jahre lang den Dienst als Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau geleistet – davon die letzten fast 14 Jahre als Pfarrerin im Schuldienst.
Dabei warst Du gebunden an die Ordinationsverpflichtung nach dem Bekenntnis und den Ordnungen unserer Kirche.
Wir danken Gott für deinen Dienst, für den Einsatz deiner Gaben und Kräfte, für deine Treue und Liebe.
Nicht alles im Dienst einer Pfarrerin liegt vor Augen. Vieles geschieht im Verborgenen. Und doch können Früchte deines Wirkens wahrgenommen werden. In der Begegnung mit Menschen in der Gemeinde, in der diakonischen Arbeit und in der Schule. Dafür sind wir dankbar.
Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für dich eine neue Lebensphase. Du bist nun frei von den dienstlichen Pflichten als Pfarrerin, als Pfarrerin im Schuldienst.
Auf Grund deiner Ordination bleibst du aber berufen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, zu taufen und die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten.
Und, dass das trotz Deiner Krankheit in deinem Leben wieder möglich werden möge, wünschen wir Dir von Herzen und bleiben Dir dabei in Gebet und Fürbitte verbunden.
Lasst uns beten.
Gott, du beschenkst deine Kirche mit guten Gaben.
Und mit Menschen, die sich durch dich zum Dienst an den Menschen berufen fühlen.
Wir danken dir für alles, was du durch Marion Eimuth gewirkt hast.
Lass sie spüren, wie viel Segen ihr Dienst gebracht hat.
Wir bitten dich: Lass ihre Mühe nicht vergeblich sein.
Wandle in Segen, was nicht gelungen ist,
vergib, was sie schuldig geblieben ist.
Und vergib uns, was wir ihr gegenüber versäumt haben.
Gib Marion Eimuth Kraft und neuen Mut für das Zukünftige.
Geleite sie auf ihrem Weg und schenke ihr den Mut, Schritt für Schritt ihren Weg in das neue Leben zu gehen, auch dabei auch das alte wiederzuerlangen.
Halte deine Hand über sie, jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
- Segen zum Abschied (mit Handauflegen)
Gott segne dir den Blick zurück und den Schritt nach vorn.
Gott bewahre in dir die Erfahrungen an diesem Ort.
Gott begleite dich auf dem Weg, der vor dir liegt
Und lasse dein Vertrauen zu ihm wachsen.
So segne dich der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
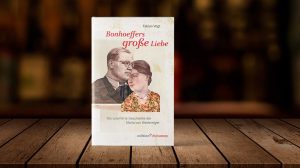 „Jahrzehntelang die Braut eines Heiligen zu sein, erweist sich nicht gerade als Vergnügen. Das können Sie mir glauben.“ Diese Worte spricht Maria von Wedemeyer in dem Roman des hessischen Theologen und Kabarettisten Fabian Vogt („Duo Camillo“). Es geht um die Liebesgeschichte zwischen dem Theologen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Dietrich Bonhoeffer und der 18 Jahre jüngeren Wedemeyer. Der Text basiert auf einem Briefwechsel des Paares – Bonhoeffer war kurz nach ihrer Verlobung im Januar 1943 verhaftet worden.
„Jahrzehntelang die Braut eines Heiligen zu sein, erweist sich nicht gerade als Vergnügen. Das können Sie mir glauben.“ Diese Worte spricht Maria von Wedemeyer in dem Roman des hessischen Theologen und Kabarettisten Fabian Vogt („Duo Camillo“). Es geht um die Liebesgeschichte zwischen dem Theologen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus Dietrich Bonhoeffer und der 18 Jahre jüngeren Wedemeyer. Der Text basiert auf einem Briefwechsel des Paares – Bonhoeffer war kurz nach ihrer Verlobung im Januar 1943 verhaftet worden.









