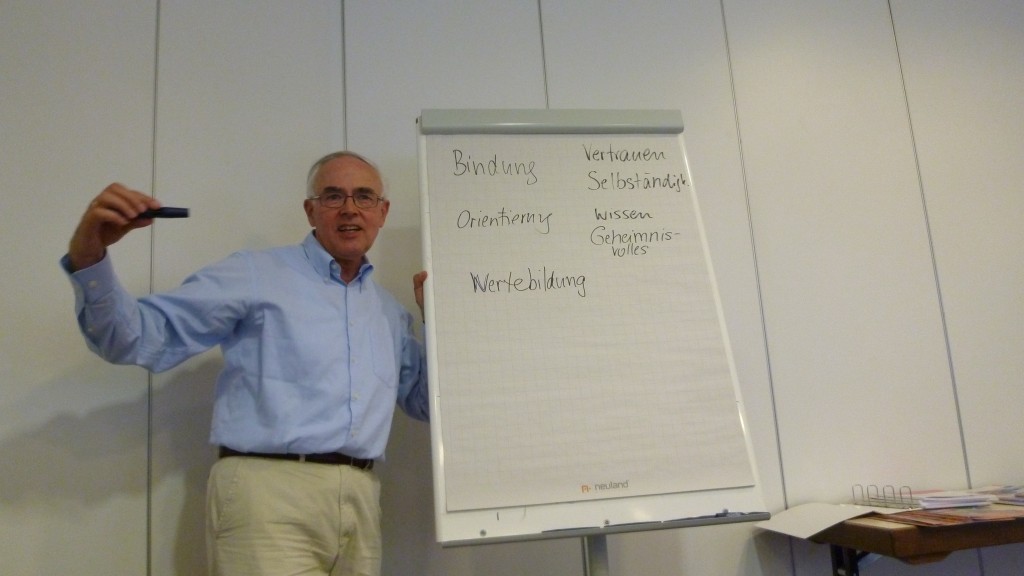Preis für Stadtteilzeitung „Wir am Dornbusch“
Zu den Gewinnern des Wettbewerbs Förderpreis Gemeindebrief 2011, der auch von der Redaktion von „Evangelisches Frankfurt“ unterstützt wird, gehörte in diesem Jahr auch die Frankfurter Dornbuschgemeinde. Den mit 1.500 Euro dotierten Hauptpreis nahm die Redaktion von „Zack“, der Gemeinde-Zeitung der Christuskirchengemeinde Bad Vilbel entgegen.
Im Auftrag der Kirchenleitung wurden die Preise vom Propst für Süd-Nassau, Sigurd Rink, in der Bockenheimer Jakobskirche überreicht. Rink sagte, der Gemeindebrief sei 2die Visitenkarte jeder Gemeinde“ und zeige die Vielfalt des kirchlichen Lebens. Er stehe auch für die Erkennbarkeit der Kirche.
Die Gemeindezeitung „Wir am Dornbusch“ nehme eine Ausnahmestellung ein, begründete Martin Reinel für die Jury die Vergabe des mit 500 Euro dotierten zweiten Preises an die Frankfurter Redaktion. Als eine der wenigen Gemeindepublikationen habe dieses Blatt „ein sehr deutliches Profil in Richtung Stadtteil“, sagte Reinel. Das Blatt, das in einer Auflage von 9.000 Exemplaren erscheint, sei journalistisch interessant. „Viele Artikel lassen Anteil nehmen am Umfeld der Gemeinde. Man liest etwas über die Schulen der Nachbarschaft, die Bürgervereinigung im Viertel, die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft oder auch über Liesel Christ, eine hessische Mutter Courage.“
Als Laudator sprach bei der alle zwei Jahre ausgelobten Preisvergabe der stellvertretende Intendant des Hessischen Rundfunks Manfred Krupp. Der Fernsehdirektor bescheinigte den lokialen gemeindlichen Medien eine hohe Professionalität. Sympathie, Empathie und der „Wunsch nach Heimat“ drückten sich darin aus. Der Hessische Rundfunk sei selbst auf Regionen des Landes und auf Nachbarschaft ausgerichtet.
Insgesamt hatten sich in dem zum achten Mal ausgetragenen Wettbewerb 116 Redaktionen mit gültigen Einsendungen beworben. Die Jury vergab nicht nur die sieben Hauptpreise und zwei Förderpreise sondern erkannte elf weiteren Redaktionen eine Anerkennung zu.
Kurt-Helmuth Eimuth
Evangelisches Frankfurt Nov 2011