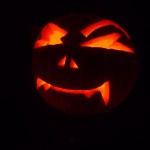Wie wird sich die evangelische Kirche in den nächsten zehn, zwanzig Jahren verändern? Was bedeuten die gegenwärtigen Reformdebatten konkret für die Stadt Frankfurt? Ein Gespräch mit Pfarrerin Esther Gebhardt und Professor Wolfgang Nethöfel.
Welche Bedeutung haben die gegenwärtigen Reformdebatten (siehe unten) für die evangelische Kirche in Frankfurt?
Gebhardt: In allen Papieren wird zum ersten Mal die besondere Situation der Großstadt gewertet und gewichtet. In Frankfurt hatten wir es immer schwer, zu vermitteln, dass wir eigene Arbeitsschwerpunkte bilden müssen und dass wir die Notwendigkeit zur Veränderung oft schon viel früher erleben und erkennen. Das klassische Gemeindemodell greift hier schon längst nicht mehr so, wie es vielleicht in ländlicheren Gebieten noch vorhanden ist.
Nethöfel: Frankfurt hat als Stadt ja auch eine europaweite Bedeutung. Entwicklungen zeigen sich hier nicht nur besonders schnell, sie verdichten sich auch stärker. Ich bin Kirchenvorsteher im Bahnhofsviertel, und das ist mit all seinen Problemen ein besonderer Stadtbezirk, wie er eigentlich nur mit Berlin und mit New York vergleichbar ist. Wir haben also eine Modellfunktion, und wir können mit guten Gründen sagen, dass wir hier in Frankfurt andere und teilweise auch mehr Ressourcen brauchen.

Hat sich die klassische Ortsgemeinde in Frankfurt überlebt?
Nethöfel: Das kann man so nicht sagen. Man kann aber in Frankfurt besonders gut zeigen, dass die traditionelle Ortsgemeinde nicht die einzige Gemeindeform sein kann. Wir brauchen unterschiedliche Gemeindeformen, und dafür muss man kirchenorganisatorisch einen Rahmen finden.
Gebhardt: In der Vergangenheit ist die Diskussion meist als ein Entweder-Oder geführt worden – auf der einen Seite die Ortsgemeinde, die sich verunsichert fühlt, auf der anderen Seite die Spezialpfarrämter, etwa in der City-Seelsorge oder in der Notfallseelsorge, die immer das Gefühl hatten, sie müssten sich legitimieren. Aber das ist eine falsche Blickrichtung. Die Differenziertheit großstädtischen Lebens zeigt ja gerade, dass es unterschiedliche Welten und Milieus gibt. Wir haben vor allem am Stadtrand Gemeinden, die dörflich strukturiert sind und ihren traditionellen Gemeindepfarrer brauchen, und wir haben Innenstadtgemeinden, in denen dörfliche Sehnsüchte und städtische Mobilität nebeneinander existieren.
Frau Gebhardt, Sie haben eine Idee aufgegriffen, die schon seit gut zwanzig Jahren in Frankfurt diskutiert wird, nämlich dass am
Wochenende verschiedene Gottesdienste zu unterschiedlichen Uhrzeiten und für unterschiedliche Zielgruppen angeboten werden müssten. Warum kriegt die Kirche das immer noch nicht hin?
Gebhardt: Weil noch immer jede Gemeinde glaubt, alle Angebote vorhalten zu müssen. Aber das wird eine einzelne Gemeinde in Zukunft nicht mehr leisten können. Sie wird sich mit ihren Nachbargemeinden zusammensetzen müssen und fragen: Wer kann was anbieten, damit möglichst viele Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen angesprochen werden? Junge Familien wollen heute häufig nicht sonntags früh zum Gottesdienst gehen, sondern sie wollen lieber in Ruhe gemeinsam frühstücken. Aber möglicherweise würde ihnen ein gemeinsamer Gottesdienstbesuch nachmittags gut passen.

Brauchen wir auch besonders hervorgehobene Kirchen, zum Beispiel die Katharinenkirche an der Hauptwache?
Nethöfel: Wenn wir der evangelischen Kirche in Frankfurt ein erkennbares Profil geben wollen, müssen wir aus der Katharinenkirche so etwas machen wie den Berliner Dom oder den Hamburger Michel. Es ist eine Riesenchance, dass wir diese prominente Kirche haben, und die müssen wir nutzen.
Das Thema im Hintergrund ist auch die Ausdifferenzierung in verschiedene Milieus, gerade in der Stadt. Welche Antworten kann eine Volkskirche da finden?
Nethöfel: Die Daten, die uns da von Soziologen geliefert werden, legen den Kurzschluss nahe, wir müssten für alle Milieus in gleicher Weise und in gleicher Stärke da sein. Aber das ist nicht richtig. Sondern wir sind für diejenigen da, die uns am meisten brauchen. Trotzdem müssen wir aufmerksam schauen, wen wir mit unserem derzeitigen Angebot wirklich erreichen, und überlegen, ob wir das so wollen. Wir sprechen als Kirche eine sehr bürgerliche Schicht an, und das wird sowohl vom Angebot als auch von der Nachfrage her immer enger.
Gebhardt: Wer Unterhaltung oder Event haben will, muss dafür nicht zwingend zur Kirche gehen. Sinnvoll finde ich den Ansatz, Orte auch vorübergehender Begegnungen zu schaffen, wie etwa Citykirchen, wo man sich nicht gleich verpflichtet, aktiv mit in das kerngemeindliche Leben einzutreten. Noch viel spannender finde ich es, zu sehen, wo die Schnittpunkte sind, an denen viele Menschen der Kirche begegnen, also im Kindergarten, bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Ich treffe immer wieder Menschen, die die Kirche bei solchen Gelegenheiten negativ oder positiv erlebt haben und zwanzig Jahre später noch darüber reden und sagen, diese Beerdigung oder diese Erfahrung war für sie so prägend, dass sie sich entweder von der Kirche ab- oder ihr neu zugewendet haben. Diese Kontakte müssen mit Sorgfalt gestaltet werden.
Könnte es also in Zukunft spezialisierte Pfarrerinnen und Pfarrer geben, weil der eine besonders gut beerdigen, die andere besonders gut predigen kann?
Nethöfel: Ein Großraum wie Frankfurt hat tatsächlich besondere Chancen, durch eine gute Personalpolitik die Menschen dorthin zu bringen, wo sie ihre Talente und Gaben auch besonders gut entfalten können. Aber dahinter steht ja noch ein anderes Problem: Religiöse Bedürfnisse äußern sich nicht nur in Formen, für die wir bereits kirchliche Angebote haben. Die Menschen gehen zum Teil ins Kino oder zu bestimmten Events, um sich dort religiös zu orientieren. Wie beantworten die Menschen denn faktisch die Frage: Woher komme ich, wo geht das Ganze hin, welchen Sinn hat es, und wie soll ich mich daher hier verhalten? Solche religiösen Kernfragen werden teilweise von den Kirchen nicht mehr zufriedenstellend beantwortet. Wir müssen uns mit unserem Angebot auch immer wieder kritisch selber in Frage stellen: Sind wir denn wirklich da, wo wir als Kirche tatsächlich gebraucht werden?
Gebhardt: Da komme ich auch noch mal zu einem Kernproblem dieser ganzen kirchlichen Reformpapiere: Wir arbeiten im Wesentlichen immer noch an der Findung neuer Strukturen vor dem Hintergrund zurückgehender Kirchensteuereinnahmen. Das ist aber nicht das Thema, mit dem wir die Herzen der Menschen gewinnen, sondern eigentlich eine Hausaufgabe, die wir stillschweigend zu erledigen hätten. Die große Herausforderung ist, wie wir auf die religiösen Fragen der Menschen antworten und wie wir ihnen überhaupt wieder helfen, ihre religiösen Fragen und ihre Suche neu zu entdecken. Was bedeutet denn die Auferstehung? Was sind die Dinge, die uns im Leben und im Sterben tragen? Was bedeutet die Trinität, der dreieinige Gott, für uns heute? Diesen Fragen sind wir in den letzten Jahrzehnten zu oft aus dem Weg gegangen. Aber hier setzt glücklicherweise auch eine Neubesinnung der Kirche ein.
Nethöfel: Ich halte es auch für eine Falle, wenn wir unseren Erfolg als Kirche von dem klassischen Kernangebot her definieren. Dieses Angebot ist ja oft fast wie ein Club organisiert, wo sich immer dieselben Leute zu immer demselben Ereignis treffen. Erfolg heißt dann: Wir finden mehr Leute, die da mitmachen. Aber eine solche Sichtweise führt, glaube ich, in eine Spirale hinein, wo der Misserfolg vorprogrammiert ist.

Zumal ja in dieser Frage, welche Antworten es auf grundlegende Sinnfragen gibt, die Kirche mittlerweile in Konkurrenz steht zu anderen Religionen, der katholischen Kirche, dem Islam, der Esoterik.
Gebhardt: Wir müssen uns angesichts dieser Konkurrenz gar nicht so sehr beängstigen lassen. Früher war mal die Esoterik das ganz große Thema, jetzt sind es vielleicht andere. Ich glaube, wir sollten einfach bei unserer Linie bleiben. Die viel größere Herausforderung sehe ich darin, was wir denen entgegensetzen, die sagen, dass sie gar keine Transzendenz brauchen, dass sie auch ohne eine religiöse Antwort oder eine religiöse Lebensdeutung leben können. Das finde ich viel spannender.
Was ist Ihre Prognose: Wie sieht die evangelische Kirche in Frankfurt in zehn, zwanzig Jahren aus?
Gebhardt: So wesentlich anders als heute wird sie nicht aussehen. Prozesse in der Kirche gehen nicht revolutionär oder eruptiv vonstatten, sondern sehr langsam. Wir werden größere Zusammenschlüsse von Gemeinden haben, die Kleinteiligkeit der derzeit sechzig evangelischen Gemeinden in Frankfurt wird sich nicht aufrecht erhalten lassen. Wir werden weniger Gebäude haben, wir werden weniger Hauptamtliche haben, dafür wird das Ehrenamt an Bedeutung und auch an Einfluss gewinnen. Die Kirche wird ärmer und wohl auch älter, wenn wir auf die demografische Entwicklung schauen. Bestimmte Schwerpunktbildungen haben wir in Frankfurt ja auch schon vorgenommen, etwa bei der Jugendkulturkirche oder der Diakoniekirche. Aber es wird auch in zwanzig Jahren noch Gemeindepfarrämter geben, und ich glaube, wir tun auch gut daran, Themen, Orte, Menschen und auch Feiertage und Feste zu profilieren und herauszustellen und weiter unsere eigenen Themen zur Sprache zu bringen. Wir werden kleiner – aber wir müssen deswegen ja nicht auch Geist-loser werden.
Nethöfel: In der Tat schwimmt da ein Tanker, und die Prozesse werden langsam und zögerlich ablaufen, etwa wie Frau Gebhardt sie beschreibt. Ich denke aber, dass in den kommenden zehn Jahren, also in einer Zeit, wo zunächst noch scheinbar alles weiter seinen Gang geht, Entscheidungen fallen, die sich dann in zwanzig Jahren erheblich auswirken werden. Ich zweifle nämlich daran, dass die rechtliche Rahmensituation, in der unsere Kirche sich heute noch befindet, als eine durch Kirchensteuer finanzierte Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Personal im Beamtenstatus, langfristig Bestand haben wird. Wie es danach weiter geht, das hängt von den Entscheidungen ab, die in nächster Zeit fallen. Das ist die spannende Herausforderung, vor der wir stehen.
Interview: Kurt-Helmuth Eimuth und Antje Schrupp