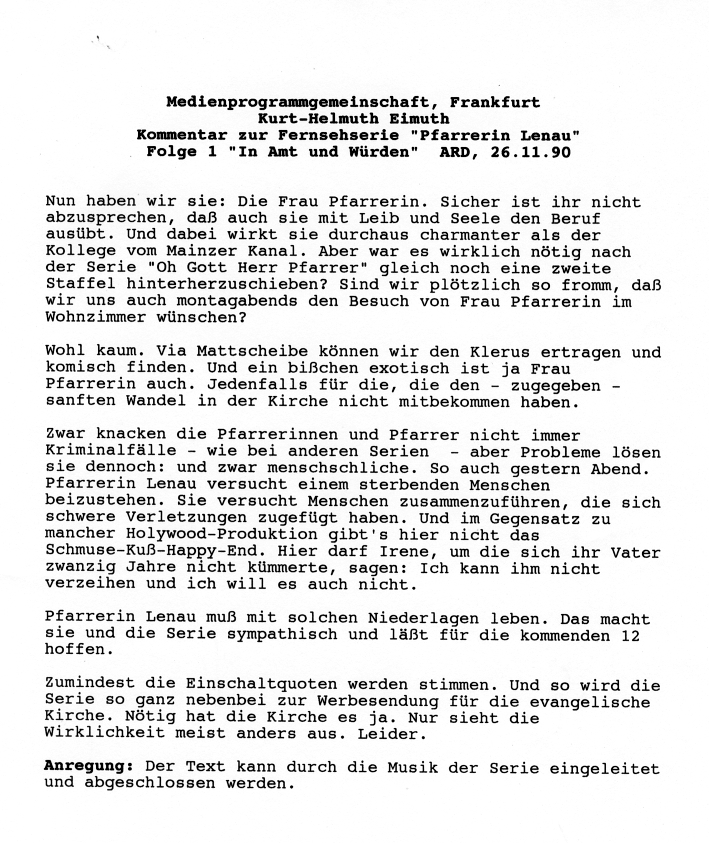Ehrlich gesagt, so richtig habe ich mich noch nicht an den Euro gewöhnt. Immer noch rechne ich schnell in die gute alte Mark um. Die menschliche Vorstellungskraft ist eben doch an den eigenen Erfahrungshorizont gebunden. Dies ist wohl ein Grund, warum im öffentlichen Bereich so munter drauflos gewirtschaftet wird. Schließlich liegen die Summen jenseits des Vorstellungsvermögens, wenn es um Millionen, vielleicht auch Milliarden geht. Oder können Sie sich vorstellen, dass Militärtransporter für 7 Milliarden Euro, das sind 7000 Millionen, angeschafft werden? Bezogen auf unsere private Bezugsgröße könnten davon etwa 14.000 komfortable Reihenhäuser in Frankfurt gebaut werden.
Der öffentliche Umgang mit Geld scheint allzu sorgenlos. Die jetzigen Haushaltsberatungen in der Stadt zeigen es. Trotz schwindender Einnahmen versuchen die Parteien ihr Klientel zu bedienen. Herauskommen wird vor allem eines: ein Defizit. Nun könnte man auch als Bürger durchaus mal mit einem Kredit leben. Aber wenn die Neuverschuldung immer weiter steigt, stellt man auf Dauer einen ungedeckten Scheck aus, den die nächsten Generationen bezahlen müssen. Nein, so darf es nicht weitergehen. Wir können nicht ständig mehr ausgeben als wir zur Verfügung haben. Und es ist eben Aufgabe des Parlaments, darüber zu entscheiden, ob sich Frankfurt als Kulturhauptstadt Europas bewerben will (geschätzte Kosten 40 Millionen Euro) oder ob eine 12 Millionen teure Olympia-Bewerbung wirklich notwendig ist. Oder ob man dafür Spielplätze in den Kindertagesstätten renoviert. Denn es ist viel Geld in der Stadt: Allein der Kulturetat beträgt 204 Millionen Euro. Das ist ein Vielfaches dessen, was die evangelische Kirche insgesamt für ihre 70 Gemeinden mit ihren 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufwenden kann: 80 Millionen Euro. Auch die Kirche führt derzeit wieder eine Diskussion ums Geld. Es wird eine Rangfolge der Arbeitsbereiche aufgestellt, denn nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch bezahlbar. Das Ergebnis dieser Beratungen wird dann auch in dieser Zeitung nachzulesen sein. Es werden Einrichtungen geschlossen, wie das Familienferiendorf Mauloff, oder Gebäude verkauft, wie die Matthäuskirche, aber es werden auch neue Projekte geplant und umgesetzt, wie etwa die Jugendkulturkirche St. Peters. Denn nur wer den Mut zur Entscheidung hat, kann die Weichen für die Zukunft stellen.
Kurt-Helmuth Eimuth
Evangelisches Frankfurt: Februar 2002 · 26. Jahrgang · Nr. 1
Archiv für Kommentare
Wenn's ums Geld geht
Pflegeversicherung in der Pflicht
Die ambulante Pflege durch die evangelische Kirche ist auf Jahre gesichert. Das Frankfurter Kirchenparlament, die Evangelische Regionalversammlung, debattierte intensiv und mit Leidenschaft, als es um die Zukunft der Diakoniestationen ging. Etwa drei Millionen Mark wird die Kirche jährlich zur Versorgung der Kranken zuschießen. Gut angelegtes Geld allemal. Doch gemessen an den erwarteten gut fünfzig Millionen Kirchensteuer, die nach Frankfurt fließen, wahrlich kein großer Brocken.
Theoretisch sollten die ambulanten Dienste vollständig von der Pflegeversicherung bezahlt werden. Zur Abrechnung werden dabei die einzelnen Handgriffe der Krankenschweister wie in der Autowerkstatt im Minutentakt eingeteilt – das ist Pflege im Akkord. Zum Beispiel darf die Schwester fünfzehn Minuten für Anfahrt und Begrüßung brauchen. Wer in Bornheim oder Sachsenhausen schon einmal einen Parkplatz gesucht hat, weiß, wie unrealistisch das ist. Die Statistik der Diakoniestationen weist aus, dass die evangelischen Schwestern im Durchschnitt achtzehn Minuten für Anfahrt und Begrüßung benötigen. Drei Minuten zuviel also, aber dafür sprechen sie auch mal ein aufmunterndes Wort zu Patienten und Angehörigen. Gerade von einem evangelischen Pflegedienst wird zu Recht erwartet, dass auch Zeit ist, sich Sorgen und Nöte anzuhören. Doch so etwas sieht die Pflegeversicherung nicht vor. Und so addieren sich eben die drei Minuten bei zehn Patientinnen und Patienten am Tag ganz schnell auf eine halbe Stunde. Das macht in der Woche zweieinhalb Stunden und im Monat gut zehn Stunden Arbeitszeit aus – die die Kirche voll zu tragen hat. Von all den anderen Leistungen, die erbracht werden und nicht abgerechnet werden können, ganz zu schweigen. Die Schwester der Diakoniestationen bringt auch mal Arzeneien aus der Apotheke mit oder es wird Nachtwache bei einem Sterbenden gehalten. Alles nicht abrechenbar, aber trotzdem notwendig.
Allein in Frankfurt zahlen Caritas und Diakonie jährlich Millionen, um diese Qualität der Pflege zu sichern. Es ist ein Standard, der eigentlich nicht übertrieben anspruchsvoll ist. Es sollte doch selbstverständlich sein, dass Pflegedienste Kranke nicht abweisen, nur weil ihr Haus nicht auf der im Fünfzehn-Minutentakt zu erreichenden Fahrtroute liegt. Hier ist die Pflegeversicherung gefordert. Sie sollte ihr Finanzierungssystem überprüfen. Die von der Kirche angemahnten Leistungen sind ja nun wirklich kein Luxus, sondern ein Mindestmaß an menschlicher Zuwendung. Man sollte daran denken, dass wir alle einmal auf solche Pflege angewiesen sein könnten.
Kurt-Helmuth Eimuth
Evangelisches Frankfurt, Ausgabe November 2000 · 24. Jahrgang · Nr. 6