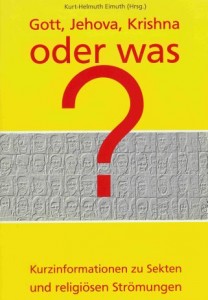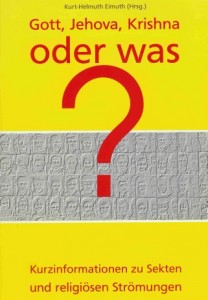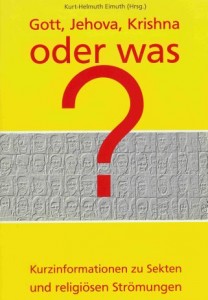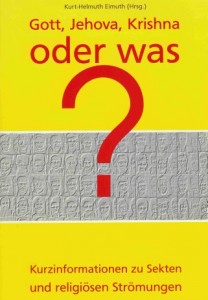Evangelisches Frankfurt September 2000
Religiöse Kunst mitten in der Stadt
von Kurt-Helmuth Eimuth
Frankfurt hat eine Skyline. Die Hochhäuser der Banken sind das augenfällige Wahrzeichen der Stadt. Längst haben die Banktürme die Kirchtürme um Längen geschlagen. Doch wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, findet inmitten der Häuserschluchten und Fußgängerzonen unvermutet Kunst mit christlichem Hintergrund. Kurt-Helmuth Eimuth flanierte für das „Evangelische Frankfurt“ durch die Innenstadt.
Kunst am und im Bau gehört zum guten Image einer Bank. Die Gestaltung des Gebäudes von UBS Schröder Münchmeyer Hengst in der Friedensstraße, unmittelbar neben dem Frankfurter Hof, irritiert. Ian Hamilton Finaly hat sechs schwarze Granitplatten, Gesetzestafeln gleich, mannshoch an der Außenfassade aufgestellt.
Finlay versteht sich als Dichter und nicht als bildender Künstler. So hat er sechs Texte ausgesucht, die er auf die schwarzen Granitplatten meißeln lies. Da die Texte in englisch gehalten sind und es schon sehr guter Sprachkenntnisse bedarf, sie zu übersetzen, blieben sie von den Passanten weitgehend unbeachtet. Doch die im Stil einer lexikalischen Definition ausgesuchten Texte mahnen, den Wert des Geldes nicht zu überschätzen. So findet sich etwa zur Definition eines Pfennigs, der als „Münze von einigem Wert“ bezeichnet wird, das Zitat aus dem Matthäusevangelium: „Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Und doch fällt von ihnen keiner zur Erde ohne meinen Vater“. Und als Mahnung für das Gemeinwesen einzustehen, wird der Überfdluss als „ein Mangel an Sack und Asche“ bezeichnet.
Inmitten des Einkaufstrubels auf der Zeil, zwischen Katharinenkirche und Kaufhof steht die Bronzeplastik „David und Goliath“ von Richard Heß. Mit dieser Arbeit wollte der 1937 in Berlin geborenen und heute in Darmstadt lebende Künstler „ein Denkmal für den erhofften Sieg des Geistes über die rohe Brutalität der Welt, der Kultur über den Kommerz“ zu schaffen.
Von den meisten Vorübergehenden wird die Plastik kaum wahrgenommen, vielleicht, weil sie als Versammlungsfläche für Menschen ohne Wohnung fungiert oder weil das Kunstwerk erst aus einer gewissen Entfernung in seiner Gesamtheit wirkt. David sitzt auf dem riesigen Kopf und den gebrochenen Gliedern des Goliath. In der Hand hält er die Steinschleuder.

Engel auf dem Klaus-Mann-Platz, Foto: Reinhard Dietrich
Eher am Rande der Innenstadt, vor dem Eldorado Kino, findet sich eine kleine Engelfigur. Zwischen Kneipen, Boutiquen und Cafés hat Rosemarie Trockel auf dem Klaus-Mann-Platz ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus geschaffen. Die Inschrift erinnert an sie, der Engel zeigt die Verletzungen. Die zart anmutende, eher geschlechtslose Figur wurde einem Gipsmodell von 1860 für das Westportal des Kölner Doms entnommen.
Doch die von Trockel geschaffene Bronzefigur weist Verletzungen auf. Die Flügel sind gestutzt und der Kopf wurde von der Künstlerin abgeschlagen und sichtbar verrenkt wieder aufgesetzt. Die Schönheit des Engels, dessen Ästhetik auch im Zusammenspiel mit dem Engel der ehemaligen Engel-Apotheke im Eckhaus gegenüber besonders hervortritt, wird durch diese Verletzungen gebrochen. In der Widmung des Mahnmals heißt es: „Homosexuelle Männer und Frauen wurden im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet. Die Verbrechen wurden verleugnet und verurteilt.“
Die Provokation dieses Kunstwerkes, aufgestellt inmitten der Schwulenszene, in unmittelbarer Nähe der von Tom Fecht geschaffenen Klagemauer für die Frankfurter Aids-Toten am Petersfriedhof, zeigt die Auseinandersetzung um den Standort. Er mußte der Kommune regelrecht abgetrotzt werden. Die Finanzierung des Kunstwerkes übernahm ebenfalls die Bürgerschaft.
U-Bahn-Station
Gänzlich unvermutet begegnet man biblischer Überlieferung im U-Bahnnetz. Beim Ausbau der neuen Linie 7 wurden zahlreiche Haltepunkte individuell gestaltet. So greift die Haltestelle „Kirchplatz“ im Stadtteil Bockenheim Motive aus der nahen Jakobskirche auf. Die Station Habsburger Allee hat Manfred Stumpf mit einem Esels-Zyklus versehen. Das Wandmosaik ist in schwarz und weiß gehalten und erinnert an den Einzug in Jerusalem.
Eine männliche Figur auf einem Esel reitend hält einen Palmzweig in den Händen. Die ingesamt 66 Esel sind – wie die U-Bahnen auch – Transportmittel. Ein Esel ist jeweils beladen, der darauffolgende nicht. Ein Esel trägt eine Frau mit Kind, Maria mit dem Jesuskind auf der Flucht nach Ägypten t. Ein Esel tritt als Engel in Erscheinung, ein anderer trägt das Kreuz als Passionswerkzeug.
Neben diesen religiösen Bildern werden auch Alltagsgegenstände und Konsumgüter transportiert, etwa Waschmaschine, Einkaufswagen, Scheckkarte, aber auch Symbole wie: eine Weltkugel, ein Atommodell, eine Wolke. Das Wandmosaik ist eine Computerzeichnung. Das einzelne Pixel des Computerbildes entspricht den quadratischen Mosaiksteinchen. Während des Wartens auf die nächste U-Bahn lädt der Esels-Zyklus zum Meditieren und Nachdenken ein. Auf die Reise des Menschen ist der Einzug in Jerusalem gleichnishaft zu übertragen.
In der U-Bahn-Station Zoo kommt die ganze bunte Tierwelt an der einen Seite der Station aus der Arche Noah heraus und auf der anderen Seite gehen die Tiere paarweise in die Arche Noah hinein. Anfangs wurde darüber debattiert, ob die kunterbunte Bilderwelt, die das Team Hans-Jürgen Dietz und Nicolas Vassilev nach Entwürfen der Malerin Hildegard Lackschewitz gestaltet hat, überhaupt Kunst sei. In frischen bunten Farben ist diese Station gestaltet. Die Tiere und Pflanzen stellen sich als Teil der Schöpfung dar. Der Regenbogen als Zeichen der Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen überspannt die Station.
Frankfurt – ein Freilichtmuseum
Fragen an den Leiter des Dommuseums August Heuser
August Heuser
Sie verwalten im Dommuseum eher Geschichte. Welche Beziehung haben Sie zur zeitgenössischen Kunst.
Ich bin ein großer Freund der zeitgenössischen Kunst. Sie ist vielfach sehr lebendig und bringt Bewegung und Auseinandersetzung ins tägliche Leben. Sie provoziert, das heißt sie ruft aus dem täglichen Trott der Gedanken und Wahrnehmungen heraus.
Frankfurt wird häufig als die Stadt des Geldes gesehen. Ist sie aber nicht auch eine Stadt der Kunst?
Natürlich ist Frankfurt eine Stadt der Kunst. Nicht nur die Museumslandschaft ist vielfältig und reich. Schauen Sie sich auf den Straßen und Plätzen der Stadt um. Da ist in den vergangenen Jahren ein richtiges Freilichtmuseum für zeitgenössische Skulptur, für Installationen und Bilder entstanden. Wenn man alles, was da nationalen und internationalen Rang hat zusammentrüge, dann müßte man in Frankfurt ein weiteres neues Museum bauen.
 Kinder und Fernsehen: Die Elterngeneration hat gelernt, dass Fernsehen dumm macht. Doch in der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts führt (fast) kein Weg am Fernsehen vorbei. In einem Workshop, veranstaltet vom evangelischen Medienhaus und dem Netzwerk Kommunikation und Medien (Komed) wurde das Kinderfernsehen untersucht und auch die Frage nach der Religion im allgegenwärtigen Medium gestellt.
Kinder und Fernsehen: Die Elterngeneration hat gelernt, dass Fernsehen dumm macht. Doch in der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts führt (fast) kein Weg am Fernsehen vorbei. In einem Workshop, veranstaltet vom evangelischen Medienhaus und dem Netzwerk Kommunikation und Medien (Komed) wurde das Kinderfernsehen untersucht und auch die Frage nach der Religion im allgegenwärtigen Medium gestellt.