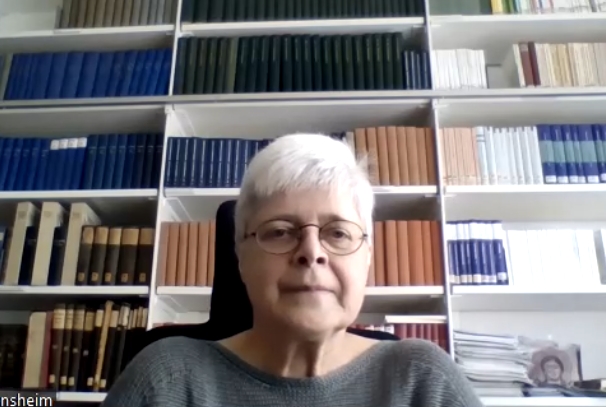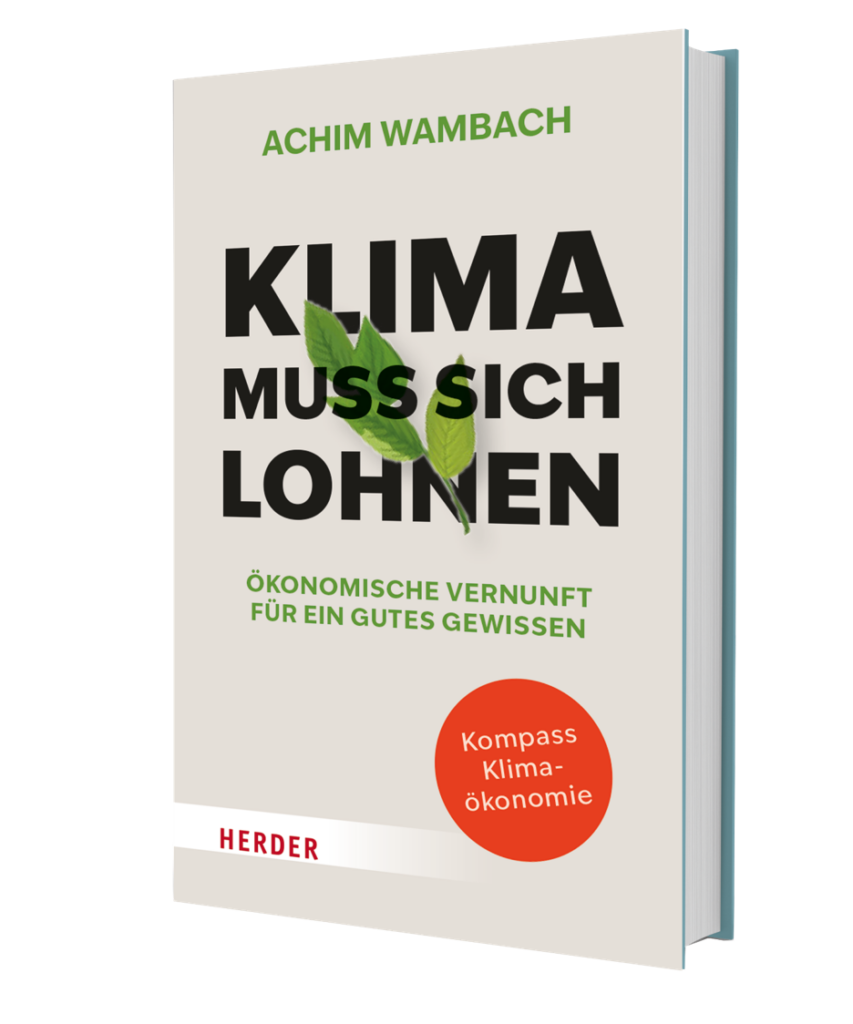von Kurt-Helmuth Eimuth
23. August 2022
Nach seinem Umzug in den Norden entdeckt unser früheres Redaktionsmitglied Kurt-Helmuth Eimuth dort mancherlei Initiative, die auch für die Kirche in Frankfurt und Offenbach inspirierend sein könnte. Zum Beispiel differenzierte und abgestimmte Gottesdienstzeiten, wie es sie seit kurzem in Lübeck gibt.

Warum nicht von Norddeutschland lernen? Die evangelischen Innenstadtkirchen in Lübeck haben seit einiger Zeit ihre Gottesdienstzeiten aufeinander abgestimmt. So können sie ein zeitlich differenziertes, den unterschiedlichen Lebensgewohnheiten besser angepasstes Angebot machen.
Im Kern geht es darum, dass die verschiedenen Gemeinden zu unterschiedlichen Zeiten Gottesdienste anbieten. So feiert die Gemeinde St. Jakobi ihren immer samstags um 17 Uhr, im Dom findet der Gottesdienst sonntags um 10 Uhr statt, in St. Marien um 12 Uhr und in der vierten Kirche bleibt es ebenfalls noch beim 10-Uhr-Sonntagsgottesdienst.
Aber es geht nicht nur um mehr zeitliche Auswahl. Mit wechselnden Formaten will man auch „spirituelle Wanderer“ erreichen, wie es in der Begründung heißt. Ein differenziertes Angebot trage auch den veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen Rechnung.
Gleichzeitig kann man auf diese Weise auch den Personaleinsatz effektiver gestalten. Eine Pastorin oder ein Pastor, aber auch die Kirchenmusiker:innen können an einem Wochenende drei Gottesdienste feiern. Auch im Norden ist ja der Mitgliederrückgang der Kirchen ebenfalls zu spüren. Die Folge sind zurückgehende Kirchensteuereinnahmen und eine Reduzierung des Personals.
Wäre das nicht auch ein Modell für Frankfurt oder Offenbach? Auch hier werden ähnliche Ideen seit Jahrzehnten intern diskutiert, aber zur Umsetzung kam es bisher nicht. Nur vereinzelt finden sich Ansätze, etwa wenn in den Sommerferien im Frankfurter Nordend die Gemeinden sich mit ihrem Gottesdienstangebot abwechseln.
Ein zeitlich und inhaltlich differenziertes Angebot der Stadtkirche wäre sicher einen Versuch wert. Ob Frauen- Taizé- oder Gospelgottesdienste – thematisch und formal zugeschnittene Gottesdienste finden dort, wo sie sporadisch angeboten werden, Zuspruch.
Aber für ein größeres Konzept müsste man von der althergebrachten Überlieferung etwas Abstand nehmen, wonach der Sonntagsgottesdienst der Sammel- und Mittelpunkt der Ortsgemeinde mit all ihren unterschiedlichen Gruppen ist. Die derzeit neu entstehenden Nachbarschaftsräume, also die verstärkte Zusammenarbeit von Gemeinden, könnten der Idee einen neuen Schub geben.
Und leider steht da ja noch etwas im Raum: Auch die Notwendigkeit des Energieeinsparens könnte eine verstärkte Konzentration von Angeboten erfordern, um Heizkosten zu sparen.
Evangelisches Frankfurt Offenbach