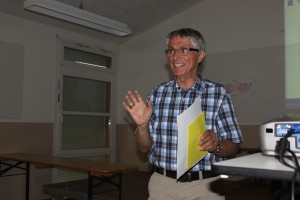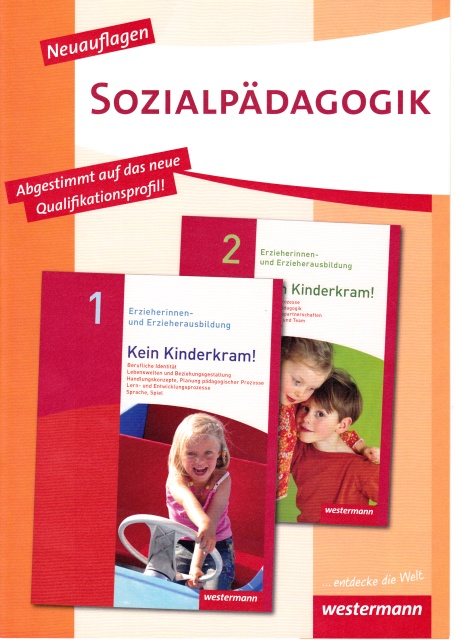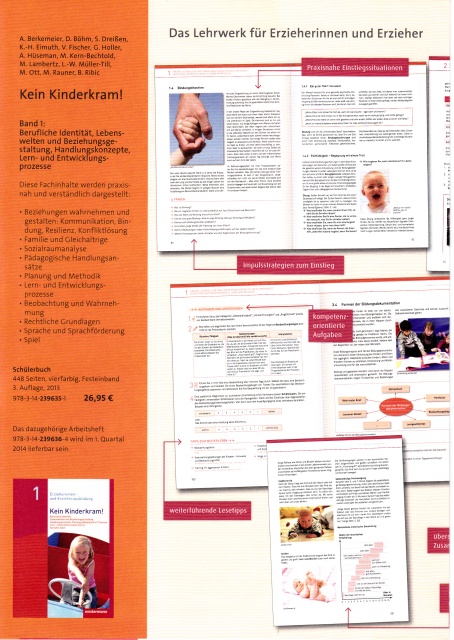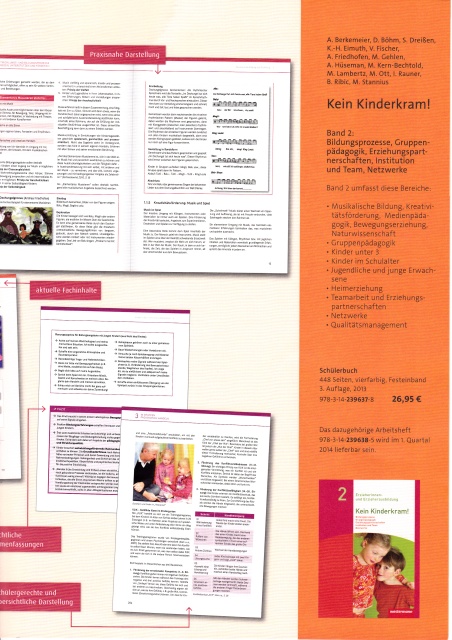Der emeritierte Münchner evangelische Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf stellt einen wachsenden Einfluss des Internets auf die Glaubenswirklichkeit der Menschen fest: „Jeder kann sich seinen eigenen Glauben zurechtbasteln.“
Dieser Differenzierungsprozess in Glaubensdingen sei zwar schon länger zu beobachten, sagte Graf bei einem Symposium der Stiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zu gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung in Frankfurt. Das Internet habe ihn jedoch massiv beschleunigt und den Kommunikationsraum von Religion „ins Unendliche erweitert“.
Um 1900 habe es weltweit rund 3.000 verschiedene Kirchen und Glaubensgemeinschaften gegeben, 100 Jahre später seien es bereits 35.000. „Jeder kann sich seinen eigenen Glauben zurechtbasteln“, resümierte Graf. In der Schweiz glaubten mittlerweile 30 Prozent der konservativen katholischen Kirchgängerinnen an die im Buddhismus verankerte Wiedergeburt, sagte Graf unter Berufung auf die religionssoziologische Studie „Jeder ist ein Sonderfall“.
Das Internet gebe religiösen Akteuren nie dagewesene Möglichkeiten, immer mehr über andere religiöse Akteure zu erfahren. Diese „wechselseitige Beobachtung“ erlaube und befördere die Übernahme von Inhalten und Denkmustern anderer. So erschienen im „Osservatore Romano“, der Tagesszeitung des Vatikans, vermehrt Beiträge über islamische Banken, in denen diskutiert werde, ob der Wall Street nicht ein Scharia-konformes Finanzgebaren guttäte. Umgekehrt werde in muslimischen Gemeinschaften über einen „unbefleckten Koran“ räsoniert, also ein Denkmuster der Marienverehrung übernommen.
Sorge bereiten dem Theologen religiöse Riten und Symbole in Computerspielen. Sie beförderten Denkmuster von einem allmächtigen Gott, die im Gegensatz zur christlichen Vorstellung eines „beobachtenden Gottes“ stünden. Das Symposium der EKHN-Stiftung hatte das Thema „Allmacht der Algorithmen? Die digitale Revolution und wie wir sie gestalten“.
Informatikerin Katharina Zweig: „Wir brauchen einen Algorithmen-TÜV“
Die Kaiserslauterer Professorin für Sozio-Informatik, Katharina Zweig, fordert eine „demokratisch legitimierte Kontrolle“ von Algorithmen im Internet und in sozialen Medien. „Wir brauchen einen Algorithmen-TÜV“, erklärte sie bei einem Symposium der EKHN-Stiftung in der Frankfurter Goethe-Universität.
Computerprogramme, mit denen das Verhalten von Personen vorhergesagt werden solle, könnten die menschliche Urteilskraft entbehrlich machen und dazu führen, dass die Gesellschaft sich zu sehr auf sie verlasse. Dies gehe weit über den individuellen Zuschnitt von Werbebotschaften im Internet hinaus.
Als Beispiel führte Zweig die Justiz des US-Bundesstaats Oregon an, deren Rechtsprechung in Strafsachen sie mit ihren Studenten analysiert habe. Dort errechneten Computerprogramme die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Straftäter erneut straffällig werde. Die Höhe der Wahrscheinlichkeit beeinflusse wiederum die Höhe des Strafmaßes. „In Algorithmen sind Menschenbilder eingefroren – aber nicht immer die richtigen“, klagte Zweig.
Algorithmen entschieden aber über die Zukunft der Menschen. „Algorithmen können jemandem einen Flug verweigern, einen Kredit, ein Visum oder ein bestimmtes Bildungsangebot.“ Die Wissenschaftlerin kritisierte, es gebe keine Partei, die sich ernsthaft mit dem Thema befasse. Sie forderte die Kirchen auf, bei der Diskussion über Algorithmen eine aktive Rolle zu übernehmen.
Digitale Konterrevolution: EU-Datenschutz gefährdet Demokratie
Was gedacht war zum Schutz des Individuums gegen Google, Facebook und Co wendet sich nun gegen jeden einzelnen, kritisiert Christoph Kucklick vom Magazin Geo bei einem Symposium der EKHN-Stiftung zu den Folgen der Digitalisierung.

Der Chefredakteur des Magazins GEO Christoph Kucklick warnt vor der Datenschutzgesetzgebung der EU. Foto: Kurt-Helmuth Eimuth
Sie ist kaum bekannt, wird im kommenden Jahr Recht in 26 europäischen Staaten und ist nach Auffassung von Christoph Kucklick eine „digitale Konterrevolution“. Die Rede ist von der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Der Chefredakteur des Magazins GEO warnte am 18. Februar auf dem Symposium „Allmacht der Algorithmen?“ der EKHN-Stiftung in der Frankfurter Universität: „Europa schützt sich zu Tode und bedroht damit bürgerliche Freiheiten.“
Was gedacht war zum Schutz des Individuums gegen Google, Facebook und Co wendet sich nun gegen jeden einzelnen. So sei etwa die Benutzung eines fremden Namens in einer Nachricht, etwa einem Tweet, an die Einwilligung des Betroffenen gebunden. Wer beispielsweise eine kritische Bemerkung zu einem Konzert von Helene Fischer machen möchte, muss zuvor die Künstlerin fragen. Weitere Forderungen, die sich aus dem Gesetz ergeben, seien etwa die Pflicht zur Unterrichtung der betroffenen Person oder auch die Pflicht zur Dokumentation und die Pflicht zur Datenportabilität. Pflichten, die von Privatpersonen kaum zu leisten seien.
Kucklick erinnerte an die Macht der Datenschutzbehörde. Sie sei die einzige Behörde, die ohne richterliche Genehmigung in Privatwohnungen eindringen und durchsuchen dürfe. Man stelle sich dieses mächtige Werkzeug einer staatlichen Behörde nur in den Händen heutiger Populisten vor.
„Wir haben nicht zuviel, sondern den falschen Datenschutz“, stellte Kucklick fest. Der Hamburger Journalist kritisierte die EU-Verordnung als zu undifferenziert. Sie gehe von der
Voraussetzung aus, dass alle Daten gefährlich seien. Der Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung führe in dieser Form zur informationellen Fremdbestimmung. „Die berechtigte Sorge um die Macht der Algorithmen wird genutzt um unsere bürgerlichen Freiheiten einzuschränken“, bilanzierte Kucklick und formulierte weiter: „Wir brauchen nicht ein Zurück, sondern ein kluges Nachvorn, einen freiheitlichen Datenschutz.“
Dossier „Algorithmen“
Algorithmen sind Chance und Gefahr zugleich: Algorithmen, also automatisierte Handlungsabfolgen, gewinnen immer mehr Einfluss auf unser Leben. Das ist aber kein Grund für Panik und unverhältnismäßige Regulierungen.
Ein neuer Star am heimischen Götterhimmel: der Algorithmus: Algorithmen haben etwas Göttliches: Sie sind allgegenwärtig, es gibt kein Entkommen, und wir sind von ihnen abhängig, ob wir wollen oder nicht. Aber wir müssen uns ihnen nicht ergeben.
Digitale Konterrevolution: EU-Datenschutz gefährdet Demokratie: Was gedacht war zum Schutz des Individuums gegen Google, Facebook und Co wendet sich nun gegen jeden einzelnen, kritisiert Christoph Kucklick vom Magazin Geo bei einem Symposium der EKHN-Stiftung zu den Folgen der Digitalisierung.
Informatikerin Katharina Zweig: „Wir brauchen einen Algorithmen-TÜV“: Die Kaiserslauterer Professorin für Sozio-Informatik, Katharina Zweig, fordert eine „demokratisch legitimierte Kontrolle“ von Algorithmen im Internet und in sozialen Medien. „Wir brauchen einen Algorithmen-TÜV“, erklärte sie bei einem Symposium der EKHN-Stiftung in der Frankfurter Goethe-Universität.
Digitalisierung beschleunigt die Ausdifferenzierung des Glaubens: Der emeritierte Münchner evangelische Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf stellt einen wachsenden Einfluss des Internets auf die Glaubenswirklichkeit der Menschen fest: „Jeder kann sich seinen eigenen Glauben zurechtbasteln.“
Kurt-Helmuth Eimuth