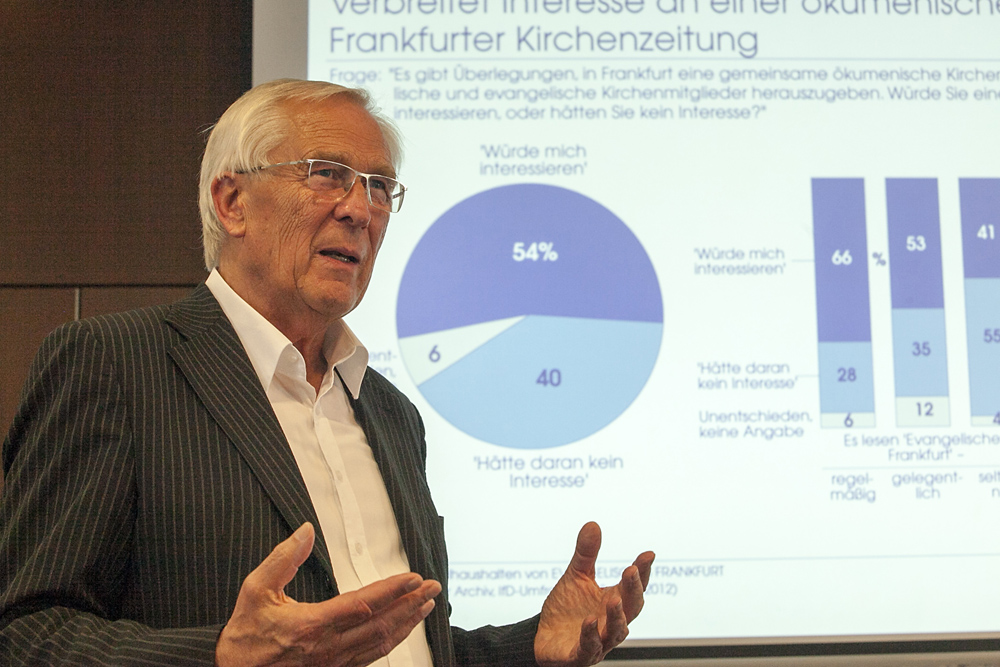Andacht am 8. Juli 2013 zur EKD-Orientierungshilfe Familie
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Selten wurde eine Stellungnahme so kritisiert aber auch wohlwollend zur Kenntnis genommen wie die Orientierungshilfe Familie, die kürzlich vorgestellt wurde.
Die Sozialwissenschaftlerin Ute Gerhard stellt das neue Bild von Familie in den Vordergrund: „Das neue Leitbild einer partnerschaftlichen, an Gerechtigkeit orientierten Familie, das eine Vielfalt unterschiedlicher Formen des privaten Lebens zulässt, ist nicht lediglich als Anpassung an den sozialen und kulturellen Wandel oder an gesellschaftlich problematische Entwicklungen zu verstehen. Im Gegenteil, maßgeblich sind die Werte und Normen, die unsere Verfassung und eine christliche Gemeinschaft tragen: Verlässlichkeit, Solidarität, Fürsorglichkeit sowie Fairness und Gerechtigkeit gerade auch in den privaten Beziehungen.“
Das idealisierte Familienbild mit Mutter, Vater und Kindern entspricht schon lange nicht mehr der Wirklichkeit. Vielfältige Lebensformen sind präsent und akzeptiert. Zum Glück ist die alleinerziehende Mutter nicht mehr stigmatisiert und auch sogenannte Patchworkfamilien sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zugegeben einige tun sich noch schwer mit homosexuellen Partnerschaften und Kindern, die in diesen Partnerschaften aufwachsen.
So ist denn auch der stärkste Vorwurf gegen die neue Orientierungshilfe der der Beliebigkeit. Die evangelische Kirche sage nicht mehr, wo es lang gehe, sondern alles sei möglich. Unser Kirchenpräsident Volker Jung hat den Vorwurf zurückgewiesen, die EKD entferne sich von den biblischen Grundlagen. Auch in der Bibel gebe es vielfältige Familienformen, sagte er. Dort komme etwa die Mehrfrauenehe vor, die Ehelosigkeit Jesu und dessen Kritik der leiblichen Familie oder die Frauengemeinschaft von Maria und Martha. Es wäre eine Engführung, die biblische Setzung der Ehe zwischen Mann und Frau ausschließlich „biologistisch“ zu verstehen. Es komme darauf an, dass Menschen grundlegend aufeinander angewiesen seien und dass sie ihre Beziehung dauerhaft und werteorientiert lebten.
Menschen haben verschiedene sexuelle Veranlagungen und sollen sich für ihre Lebensform frei entscheiden können. Dies ist die Aussage der Orientierungshilfe.
Dabei kommt es vor allem darauf an, wie wir miteinander umgehen: verlässlich, fürsorglich, solidarisch. Und tatsächlich ist es doch ein wunderbares Gefühl der Sicherheit zu wissen, egal was passiert, meine Familie ist für mich da. Sie ist ein sicher Hafen. Da bin ich geborgen, ganz gleich wie stürmisch die Welt da draußen sein mag.
Die Psychologen nennen eine solche Haltung Urvertrauen. Wir wissen, dass dieses Urvertrauen ein ganzes Leben trägt. Es ist jenes Vertrauen, das kleine Kinder ihren Eltern entgegegnbringen. Die Eltern können alles und könnnen deshalb auch alle Ungemach vom Kinde fernhalten. Hier liegt die Wurzel für die Ich-Stärke, die den Erwachsenen durchs Leben trägt. Hier liegt aber auch die Wurzel für einen späteren Glauben. Denn nur wer ein solches unabdingbares Vertrauen kennen gelernt hat, hat erfahren, dass Gott einen tragen kann. Auch in Krisen.
»Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde
Gottes schuf er ihn; und er schuf sie als Mann und Frau.«
Mit diesen Worten aus dem zweiten Schöpfungsbericht
beginnt die Textzusammenstellung, die hierzulande aus der Trauliturgie vertraut ist. Am Ende steht dann das bekannte Jesuswort aus Matth 19,6: »Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden«:
Mit der Agende erinnert die Kirche in jedem Traugottesdienst an das große Glück, einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden. Füreinander geschaffen zu sein und »auf ewig« zueinander zu gehören, das entsprecht dem Lebensgefühl der Paare bei ihrer Hochzeit, so die Orientierungshilfe. Doch sie seien kein Schutzwall gegen alle Erfahrung zerbrechender Beziehungen. Der »kirchliche Segen«, den die Paare und ihre Familien erbitten, soll die Liebe stark machen. Dabei wird ernst genommen, dass es in der Ehe keine Garantie für menschliches Glück gibt, vielmehr gilt das Trauversprechen gerade »in guten wie in bösen Tagen«. Denn »es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei«. Über der inneren Zustimmung zu dieser Erfahrung kann in den Hintergrund treten, was uns heute in diesen Texten fremd ist, etwa dass das Schöpfungsgeschehen vom Mann her gedacht ist, die Frau als »Gefährtin« des Mannes verstanden wird, als »Hilfe, die ihm gleich sei« – oder dass das Paar einander, vor allem aber die Frauen ihren Ehemännern »untertan sein sollen«, weil »der Mann des Weibes Haupt« sei (Eph 5).
Lange Zeit hat diese Vorstellung unser Bild von Ehe und Familie geprägt. Und doch sah und sieht die Wirklichkeit ganz anders aus:
In vorindustrieller Zeit hatten Ehe und Familie vor allem einen instrumentellen Charakter. Die Ehe wurde nicht aus Liebe geschlossen, sondern im Hinblick auf die Kinder und zwar um – je nach Schicht – Vermögen oder zumindest den Namen zu vererben und um im Falle von Krankheit und Alter die Versorgung der Familienmitglieder zu garantieren.
In der vorindustriellen Zeit waren die Familien geprägt durch ihre sozial-ökonomische Lage. Im Mittelpunkt stand der „Haushalt“, es waren Haushaltsfamilien. Bei den Besitzenden umschloss dies den Produktionsbetrieb mit ein. Der „Hausvater“ und die „Hausmutter“ hatten eine genau definierte Rolle auch im Handwerk, Bauernhof oder Gewerbe. Zum Haus gehörten auch etwa Knechte und andere Bedienstete.
Bei den ärmeren Schichten stand auch die ökonomische Funktion des Hauses im Mittelpunkt, auch wenn weit weniger Mitglieder das Haus hatte. Erwerbstätigkeit beider Eltern und der Kinder waren selbstverständlich.
Auch damals gab es sehr verschiedene Lebensformen. Vor allem Verwitwung – wegen der geringen Lebenserwartung – und ledige Mutterschaft waren oft die Ursache hierfür.
Vor etwa 200 Jahren entwickelte sich – zunächst im städtischen Bürgertum – die Form der Liebesheirat. Von vielen Autoren wird dieser Übergang als Funktionsverlust der Familie beschrieben. Institutionen übernehmen jetzt Funktionen, die früher die Familie hatte, z.B. Krankenhäuser. Schulen, aber auch Polizei und Justiz.
Der Familie bleibt die Funktion der Nachwuchssicherung und die der physischen und psychischen Regeneration ihrer Mitglieder, gleich ob jung oder alt.
Über all die Jahrhunderte war die Erwerbstätigkeit der Mütter eine ökonomische Notwendigkeit. Lediglich das Bürgertum konnte sich die nicht-erwerbstätige Mutter leisten. Die Nicht-erwerbstätige Mutter wurde im sog. Dritten Reich dann ideologisch überhöht und durch Ehestandsdarlehen vom Arbeitsmarkt abgeworben und bei vier Kindern mit dem Mutterkreuz geschmückt. Zur Kriegsproduktion brauchte man dann wieder die Frauen, was die Nazi-Ideologen in Argumentationsnöte brachte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg behielt die Bundesrepublik das Familienmodell bei, auch wenn die Realität der Trümmerfrauen anders aussah. Auch in den 50er Jahren war die Erwerbstätigkeit der Mütter aus ökonomischen Gründen notwendig.
In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sah es dann anders aus. In jener Zeit war die mütterliche Erwerbstätigkeit am niedrigsten.
Zusammenfassend muss also betont werden, dass das bürgerliche Familienmodell zwar über 200 Jahre als Ideal galt und noch heute für manche Kreise der Bevölkerung gilt, als Lebensform aber für die breite Bevölkerung in allen seinen Dimensionen nur für zwei Jahrzehnte realisiert wurde, sich also – historisch gesehen – als kurzes Zwischenspiel entpuppt.
Auch im Alten und Neuen Testament ist das familiale Zusammenleben in einer großen Vielfalt beschrieben: Nach heutigen Begriffen gibt es Patchwork-Konstellationen wie bei Abraham, Sarah und Hagar mit ihren Kindern, zusammenlebende Geschwister wie bei Maria und Martha und tragende Beziehungen zwischen Familienmitgliedern verschiedener Generationen wie bei Rut, Orpa und Noomi. Von den vielfältig beschriebenen Formen des Zusammenlebens sind aus heutiger Sicht einige leichter, andere schwerer nachvollziehbar: Die gleichzeitige Sorge eines Mannes für zwei Frauen und ihre Kinder wie bei Jakob mit Lea und Rahel erscheint heute vielleicht weniger befremdlich als noch für unserer Eltern- oder Großeltern-Generation, dagegen können wir den Druck auf Frauen, Mutter eines »Stammhalters« zu werden, immer weniger nachvollziehen. Dass im alten Israel mit der Heirat ein patriarchales Eigentumsverhältnis konstitutiert wurde, wobei mehrere Frauen Eigentum eines Mannes sein konnten, gehört zu den vergessenen Teilen der jüdisch-christlichen Geschichte; manches davon kehrt wieder in den Auseinandersetzungen mit anderen Kulturen und Religionen. Klar ist jedenfalls: Im Mittelpunkt der biblischen Familiengeschichten steht weniger die persönliche Liebesbeziehung oder das individuelle Glück als der Erhalt und das Wachstum der Familie und ihres Besitzes und das Miteinander der Generationen.
Natürlich beschreibt die Bibel auch die Liebe, die Konflikte zwischen Alt und Jung, das Ringen um einen geliebten Menschen. In den Erzählungen finden wir die ganze Vielfalt der Gefühle des partnerschaftlichen und familiären Beziehungslebens: Erfahrungen von Verlust, Eifersucht und Scheitern stehen neben Versöhnung, überschäumendem Glück und tief gewachsenem Vertrauen. Die Bibel erzählt von der Freude über die gefundene Liebe wie bei Isaak und Rebekka und von der großen Liebe zwischen Jakob und Rahel, für die Jakob sieben Jahre bei seinem Verwandten Laban arbeitete – »und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie«. Das »Hohelied« feiert in poetischen Worten die Schönheit und das Glück der sexuellen Begegnung, während die Geschichte
von David und Bathseba auch Ehebruch und Intrige beim Namen nennt. Die Bibel erzählt von der Kindersegnung Jesu und der Sorge von Eltern, die sich bei Jesus um eine Zukunft für ihre kranken Kinder einsetzen, aber auch von der Macht der Väter und dem Gehorsam, den Familien den Frauen wie den Söhnen und Töchtern abverlangten. Wer sie liest, entdeckt große Familien- und Liebesgeschichten, die nicht nur die Weltliteratur, sondern auch unser Verständnis vom Miteinander in Familien prägten. Sie zeugen aber auch von kulturellen Traditionen, gesellschaftlichen Zwängen und einem überholten Rollenverständnis.
Die EKD ist überrascht von der heftigen Reaktion auf das Papier. Nein, eine Schwächung der Familie kann man in dem Papier nicht entdecken. „Wie man aus einem solchen Text herauslesen kann, dass es um eine Schwächung der Familien geht oder um eine Vergleichgültigung, dass eheliche Formen der evangelischen Kirche nicht mehr wichtig sind, ist mir unverständlich“, erklärte Bischof Ulrich Fischer, der auch Mitglied des EKD-Rates ist. Das Dokument sei eine „riesige Werbung dafür, Mut zu haben zur Familie, Kinder zu bekommen, Familie zu gründen und Verantwortung zu übernehmen“. Der Typus von Familie habe sich in seiner sozialen Gestalt unglaublich geändert, betonte der Landesbischof. Dem trage diese Orientierungshilfe Rechnung. Und auf den Punkt brachte es Margot Käßmann: „Die evangelische Ethik hat sich nicht dem Zeitgeist angepasst, sondern geguckt, was sind ihre Grundkategorien.“ Wichtig seien vor allem Verlässlichkeit, Vertrauen und der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen.
Amen